Meinungen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
Wir machen Platz für Meinungen und Positionen: In Interviews befragen wir Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Präsidenten, Vizepräsidenten sowie Experten aus Mitgliedshochschulen und Unternehmen zu Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Pflege und Cyber-Security. Persönlich und direkt. Ein Thema – zwei Stimmen. Hier erfahren Sie mehr.
Unser Thema im August 2021:
Digitalisierung im Gesundheitswesen

© Peter Preuß
Peter Preuß | CDU-Landtagsfraktion
MdL und Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. In der Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation werden mittlerweile an vielen Stellen digitale Anwendungen und Verfahren eingesetzt. Ich denke beispielsweise an Telekonsile, die fachärztliche Expertisen von Spezialisten für Hausarztpraxen verfügbar machen. Auch das im vergangenen Jahr an den Start gegangene Virtuelle Krankenhaus dient als digitale Plattform dazu, die fachärztlichen Expertisen landesweit zu vernetzen und besser zugänglich zu machen.
In der Corona-Pandemie hat der Einsatz von telemedizinischen Diensten einen Entwicklungsschub erhalten. So haben, um ein Beispiel zu nennen, viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte das Angebot, eine Videosprechstunde für ihre Patientinnen und Patienten anzubieten, eingerichtet oder ausgebaut.
Die Chancen der Digitalisierung sehe ich in einer Bündelung fachärztlicher Kompetenz und Expertise sowie einem erleichterten und schnelleren Austausch über Diagnosen- und Behandlungsmöglichkeiten. Durch die Digitalisierung wird die sektorenübergreifende Versorgung zwischen den niedergelassenen Praxen und den Krankenhäusern vorangetrieben. Zudem bietet der Einsatz telemedizinischer Anwendungen für das Verhältnis zwischen Arzt und Patient Vorteile. Beispielsweise können Videosprechstunden oder elektronische Visiten in Pflegeheimen immobilen Patientinnen und Patienten belastende und aufwändige Anfahrtswege ersparen.
Letztendlich soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen kein Selbstzweck sein. Sie dient vielmehr dazu, medizinisches und pflegerisches Personal bei ihrer Arbeit optimal zu unterstützen, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen lassen zu können.
Die Digitalisierung birgt natürlich auch Risiken. So muss der Datenschutz, d. h. der Schutz und die Vertraulichkeit von Patientendaten auch bei digitaler Nutzung immer gewährleistet sein. Beim Einsatz von Telemedizin sollte auch stets im Blick behalten werden, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin bzw. Arzt und Patientin bzw. Patient durch die räumliche Distanz leiden könnte.
Entwicklungspotential sehe ich zum Beispiel im Einsatz elektronischer Patientenakten oder elektronischer Rezepte (eRezept). Sie werden von etlichen niedergelassenen Praxen noch nicht genutzt.
Bei der digitalen Vernetzung zwischen Krankenhäusern/Praxen und den Patientinnen und Patienten gibt es ebenfalls Entwicklungspotential. So wird, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, das Auftreten von Long-Covid-Symptomen interdisziplinäre Behandlungen mit einer stärkeren digitalen Vernetzung erforderlich machen.
In der aktuellen Pandemiebekämpfung zeigt sich, dass es an verschiedenen Stellen im Gesundheitswesen noch digitalen Nachholbedarf gibt. Die Gesundheitsämter sind teilweise mit der Nachverfolgung von Corona-Kontakten überfordert, weil ihnen die digitalen Möglichkeiten fehlen. In diesem Bereich sind technische Investitionen erforderlich.
Mit ihrer anwendungsorientierten Forschung leisten die Hochschulen für angewandte Wissenschaften einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die großen Stärken der HAWs sind das wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Studium, das die Studierenden optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Für die technologischen und digitalen Herausforderungen im Gesundheitswesen werden Fachkräfte mit hoher digitaler Kompetenz benötigt, die gelernt haben, das theoretische Wissen anwendungsbezogen umzusetzen. Das Studium an den HAWs bietet dafür sehr gute Voraussetzungen.

© HS Gesundheit
Prof.in Dr.in Eike Quilling | Hochschule für Gesundheit
Professorin für Gesundheitspädagogik und -kommunikation, Vizepräsidentin für Forschung und Transfer
Wir können in den letzten Jahren große Fortschritte im Bereich der digitalen Gesundheitsver-sorgung verzeichnen – beispielsweise stellt die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) als zentrales Element der vernetzten Gesundheitsversorgung grundsätzlich einen großen Schritt in die richtige Richtung dar. Zudem bieten neue technische Entwicklungen – wie zum Beispiel Pflegeroboter – vielfältige Möglichkeiten, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu optimieren.
Dennoch steht die Digitalisierung des Gesundheitswesens in vielen Bereichen in Deutschland noch relativ am Anfang und es gibt viel Entwicklungspotential. So zeigt der eHealth Monitor 2020 (McKinsey, 2020), dass 93 Prozent der der ambulanten Praxen im vergangenen Jahr noch überwiegend in Papierform mit Krankenhäusern kommunizierten. Den Angaben des Berichts zufolge tauschten insgesamt nur 44 Prozent der deutschen Gesundheitseinrichtungen Patientendaten in digitaler Form aus, während in Österreich bereits 88 Prozent der Patienten-daten digital ausgetauscht werden.
Für eine erfolgreiche Gesundheitsversorgung ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung und bessere Integration innovativer Versorgungsansätze von zentraler Relevanz. Die Verknüpfung von Gesundheitsdaten bietet, insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft mit multimorbiden Krankheitsbildern das Potential, ein individuelles und zugleich ganzheitliches Bild des Gesundheitszustandes einer Person zu gewinnen. Diese Daten können dann, ebenso wie Behandlungsfortschritte, digital dokumentiert und allen beteiligten Versorgungseinrichtungen für die Behandlung der Patient*innen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden.
Enormes Innovationspotential bieten zudem digitale Gesundheitsanwendungen und Technologien wie Künstliche Intelligenz, die einerseits auf die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen und andererseits auf Bedarfe z.B. in der Pflege zugeschnitten sind. So könnten beispielsweise Routineaufgaben durch Roboter übernommen und dadurch Pflegepersonal effektiver eingesetzt werden. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist aber auch mit Risiken verbunden. Der Umgang mit den personenbezogenen Daten erfordert eine hohe Sensibilität. Der Schutz der Patientendaten muss hierbei immer an oberster Stelle stehen.
Die Digitalisierung bietet großes Entwicklungspotential für effektivere und effizientere Versorgungsabläufe. Die IT-Vernetzung zwischen Biodatenbanken, moderne Analysemethoden und Gesundheitsapps ermöglichen zudem die Analyse großer Datenmengen – beispielsweise mittels Machine-Learning-Verfahren. Diese können komplexe diagnostische und therapeutische Fragen adressieren sowie für innovative Forschungsvorhaben im Sinne einer personalisierten Medizin genutzt werden. Die Künstliche Intelligenz stellt hierbei die Schlüsseltechnologie der Zukunft dar.
Die Anwendungsorientierung im Blick, leisten die HAW durch ihre Studienangebote und Forschung einen zentralen Beitrag zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die HS für Gesundheit in Bochum bildet beispielsweise in einem Studiengang Studierende zu interprofessionellen Akteur*innen im Schnittstellenbereich ‚Gesundheit und Datenmanagement‘ aus und bereitet sie auf einen zukunftsträchtigen Arbeitsmarkt vor. Zudem werden in zahlreichen Forschungsprojekten digitale Lösungen zur Unterstützung der Gesundheitsbranche entwickelt. Die anwendungsorientierte Forschung der HAW leistet einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Unser Thema im Mai 2021:
Das Promotionskolleg NRW

© Bettina Engel-Albustin/MKW 2017
Isabel Pfeiffer-Poensgen | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW
Ministerin
Das Land Nordrhein-Westfalen hat durch die Novellierung des Hochschulgesetzes im Sommer 2019 die Voraussetzungen dafür geschaffen, das Graduierteninstitut für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen in das sog. „Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ zu überführen. Das auf dieser Grundlage im Dezember 2020 neu gegründete Promotionskolleg NRW soll es den HAW ermöglichen, Promotionsverfahren durchzuführen und den Doktorgrad für Studierende zu verleihen.
Das Promotionskolleg NRW ist durch seine Netzwerkstruktur einzigartig und baut maßgeblich auf den charakteristischen Kompetenzen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) auf. Die 21 Trägerhochschulen aus allen Regionen Nordrhein‐Westfalens sind hier eingebunden. So entsteht ein ständiger fachlicher Austausch zwischen den verschiedenen thematischen Abteilungen des Promotionskollegs NRW, in denen Professorinnen und Professoren sowie Promovierende aus den Trägerhochschulen und den eingebundenen Universitäten miteinander konkrete Forschungs- und Promotionsvorhaben initiieren.
Ich bin zuversichtlich, dass, nicht zuletzt durch die im Promotionskolleg NRW verstärkte wissenschaftliche Vernetzung, Bedingungen geschaffen werden, unter denen erfolgreiche und qualitätsgesicherte Promotionen zur Stärkung der Nachwuchsförderung ermöglicht werden. Die HAW können so ihre besonderen Potentiale noch weiter entfalten.
Dieser neue, vom Parlament initiierte und von der Landesregierung vorangetriebene Weg, zeichnet sich auch dadurch aus, dass eine Begutachtung durch den Wissenschaftsrat erfolgt, bevor dem Promotionskolleg NRW das Promotionsrecht durch das Land verliehen werden kann. Das ist meines Erachtens ein zentraler Punkt. Der Wissenschaftsrat stellt fest, ob eine wissenschaftliche Gleichwertigkeit zu den Promotionen an Universitäten besteht. Damit werden die hohen Ansprüche an die wissenschaftliche Qualität von Promotionen gesichert. Denn es ist unser gemeinsames Ziel, dass Promotionen am Promotionskolleg am Ende die gleiche Akzeptanz finden, wie Promotionen an Universitäten.
Der wesentliche Unterschied zu Promotionen an Universitäten und damit die Besonderheit des Promotionskollegs NRW ist die Schwerpunktsetzung: Die HAW zeichnen sich vor allem durch ihre Anwendungsorientierung und ihren direkten Bezug insbesondere zu mittelständischen Unternehmen aus. Sie sind deshalb ein wichtiger regionaler Ansprechpartner für die Verwirklichung innovativer anwendungsorientierter Ideen, Technologien, Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Aufbauend auf diesen, zum Teil schon vorhandenen, Strukturen und Aktivitäten der HAW, wird die Forschung durch das Promotionskolleg NRW in diesem wichtigen Bereich weiterentwickelt. Ein solches Modell, mit dem die Forschung im anwendungsorientierten Bereich für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler gestärkt wird, halte ich wissenschaftspolitisch für erfolgsversprechend und zukunftsweisend.
In der Tat ist es den HAW gerade in den letzten Jahren gelungen, in sehr beachtlicher Weise eigene Forschungsschwerpunkte auf- und auch auszubauen. Sie sind damit wichtige Partner, auch in größeren Netzwerken mit Universitäten und Forschungsinstituten außerhalb der Hochschulen. Beispiele sind die Forschung im Bereich Industrie 4.0, die Batterieforschung oder die Forschung zu IT- und Internetsicherheit. Insofern profitiert von einem guten Promotionsangebot nicht nur die Forschung an den HAW selbst.
Eine große Herausforderung, insbesondere für die Nachhaltigkeit der Strukturen, ist es bisher noch, den hervorragend qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs auch im neu aufgebauten Schwerpunkt halten zu können. Die bisherigen Formen kooperativer Promotionen mit Universitäten waren da schon eine Hilfe, konnten aber letztlich ebenfalls nicht vermeiden, dass gerade die Besten – eben wegen der Promotion – die HAW verlassen. Hier erwarte ich eine deutliche Verbesserung durch das Promotionskolleg, indem dem wissenschaftlichen Nachwuchs hochattraktive Qualifizierungsangebote innerhalb des Forschungsschwerpunktes und an der HAW selbst gemacht werden können. Davon profitiert der an einer wissenschaftlichen Laufbahn interessierte Nachwuchs, davon profitiert die Hochschule und davon profitieren letztlich auch alle beteiligten Partner im konkreten Forschungsfeld.
Der Schwerpunkt in der Forschung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften liegt – wie bereits betont – auf der Anwendungsorientierung. Durch das Promotionskolleg NRW ist zu erwarten, dass auch in genau diesem Bereich die Promotion als selbstständig forschende wissenschaftliche Tätigkeit gestärkt wird. Ermöglicht werden soll hierdurch die Einordung der eigenen Forschung in einen breiteren wissenschaftlichen Kontext und vor allem der Transfer in die Praxis. Der Wissenstransfer in die Gesellschaft sowie das Nutzbarmachen von Anregungen aus der Gesellschaft sind wichtig für die Weiterentwicklung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie tragen wesentlich zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts und damit zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlstands in Nordrhein-Westfalen bei. Das Promotionskolleg NRW bündelt die wissenschaftlichen Kompetenzen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Nordrhein‐Westfalen und eröffnet berufliche Perspektiven für junge Nachwuchskräfte.
In der Verbesserung der Wege zur Promotion für Studierende an den HAW sehe ich eine große Chance der besseren Ausschöpfung des in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Nachwuchspotentials. Denn forschungsstark sind auch viele Absolventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge der HAW. Genauso spricht das Promotionskolleg NRW aber auch hervorragend qualifizierte Absolventinnen und Absolventen von Universitäten an, die verstärkt anwendungsorientiert forschen möchten. Die universitäre Forschung verliert hierdurch nicht an Bedeutung, denn für den Wissenschaftsstandort NRW ist gerade die gute Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften der Schlüssel zum Erfolg: Die Entwicklung von praktischen Anwendungsfeldern wäre nicht möglich ohne die durch exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Universitäten stattfindende Grundlagenforschung. Hierdurch wird der entscheidende Grundstein für die praktische Entwicklung von Innovationen gelegt. Wesentlich ist, dass diese Schnittstellen gut miteinander verknüpft sind und zusammenarbeiten. Das Promotionskolleg NRW wird hierzu – als maßgeblicher Knotenpunkt – einen wichtigen Beitrag leisten.

© Anna Wawra Peoplefotografie
Prof.in Dr.in Liane Schirra-Weirich | katho NRW
Stellv. Vorsitzende Promotionskolleg für angewandte Forschung in NRW
Durch den Zusammenschluss der beteiligten HAW in NRW ist eine forschungsstarke Kooperationsplattform entstanden, die aufgrund ihrer Vernetzungsstruktur eine höhere Reichweite entwickelt als 21 solitär arbeitende und forschende Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Die Abteilungen des PK NRW werden gespeist aus den Potentialen und Ressourcen der forschungsstarken Professor*innen der Fachbereiche bzw. Fakultäten der Trägerhochschulen. Sie sind Orte des vernetzten Arbeitens und Forschens und entfalten ihre Wirkung als Kristallisationspunkte für Forschung, Innovation und Transfer für interdisziplinär orientierte Forschungsthemen und -fragestellungen.
Die Zusammenarbeit erfolgt kollaborativ über die Grenzen der einzelnen Hochschulen hinweg und wird im Rahmen von strukturierten Nachwuchsförderprogrammen organisiert. Damit steht dem wissenschaftlichen Nachwuchs neben einem fundierten und tragfähigen Forschungsumfeld, auch ein strukturierter und planbarer Prozess der Qualifizierung zur Verfügung.
Ein derartig gerahmter und geordneter Prozess der akademischen Nachwuchsförderung bietet in mehrfacher Hinsicht Sicherheit und Planbarkeit, beim gleichzeitigen Erhalt des Fokus auf die eigene selbstständige Forschung. Die strukturierte Nachwuchsförderung definiert die Anforderungen an die Promovierenden und regelt individuell den zeitlichen Rahmen, in dem eine Promotion erfolgreich abgeschlossen sein soll. Die Promovierenden verfügen damit eigenständig über Instrumente der Fortschrittsmessung und können gestaltend mitwirken. Nicht zuletzt unterstützen die strukturierten Fördermaßnahmen, die im Rahmen entsprechender Promotionsprogramme stattfinden, die verstärkte Zusammenarbeit der Promovierenden. Im Gegensatz zur klassischen, isolierten Promotion wird der kooperative Gedanke durch Vernetzung und regelmäßigen wissenschaftlichen Diskurs gestärkt.
Es gibt viele Gründe, warum ich das PK NRW wissenschaftspolitisch als neuen und besonderen, aber auch als einen sehr guten Weg begrüße. Zunächst einmal eröffnet dieses Modell einen weiteren Weg der Promotion. Neben der Promotion an der Universität und der kooperativen Promotion wird ein dritter Weg, die Promotion am PK NRW, eröffnet. Perspektivisch entsteht damit auch die Chance eines vierten Weges, die gemeinsame Promotion in Analogie zu einem Cotutelle-Verfahren.
Darüber hinaus ist der Netzwerkgedanke und die damit verbundene Kooperationsplattform eine adäquate Organisationsform für drittmittel- und publikationsstarke HAW-Kolleg*innen. Das PK NRW bündelt die an gängigen Qualitätskriterien gemessenen forschungsstarken Professor*innen und spiegelt die hohe Qualität der HAW-Forschung wider.
Ein weiterer Grund sind die Synergien, die erzielt werden. Die HAW kooperieren im Bereich der Forschung und der Nachwuchsqualifizierung und treten nicht zueinander in Konkurrenz. Dadurch werden die Ressourcen von großen, mittleren und kleineren HAW über alle Disziplinen hinweg genutzt. Statt in konkurrierenden Situationen um begrenzte Mittel zu kämpfen, können Potentiale gebündelt werden, um kooperativ Forschungsmittel zu akquirieren und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu qualifizieren. Damit werden sowohl die HAW als auch die in ihr stattfindende Forschung strukturell gestärkt.
Nicht zuletzt spricht ein eher bildungspolitischer Aspekt für den neuen wissenschaftspolitischen Weg. Die Differenzierung der akademischen Nachwuchsförderung setzt die Differenzierung des akademischen Ausbildungssystems konsequent fort, ohne die Spezifika von HAW und Universitäten aufzuheben. Das PK NRW mit einem eigenständigen Promotionsrecht ermöglicht Absolvent*innen der HAW, die vielfach Bildungsaufsteigende sind, den Weg der wissenschaftlichen Qualifizierung zu beschreiten. Dies ist ein weiterer Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit und zum Abbau von Diskriminierungen in Folge von sozialen Selektionsprozessen im Bildungswesen. Gleichzeitig werden damit weitere Potentiale gehoben und der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort NRW gestärkt.
Ein eigenständiges Promotionsrecht stärkt die HAW u.a. im Bereich der Akquise und Bindung von Mitarbeiter*innen. Qualifizierten Mitarbeiter*innen werden Perspektiven eröffnet, im HAW-Kontext zu promovieren und sich u.a. auf eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten. Der Bereich der anwendungsorientierten Forschung an HAW wird zu einem Feld qualifizierter Nachwuchsförderung.
Darüber hinaus werden die HAW-spezifischen Forschungsfelder, die vielfach inter- und transdisziplinär orientiert sind, gestärkt. Eine multidisziplinäre Perspektive auf inter- und transdisziplinäre Forschungsfragen überwindet die Grenzen disziplinärer Erkenntnisgewinnung und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Anwendungsorientierung.
Von diesem Ansatz profitiert insbesondere die Forschung in Fächern, die nicht oder nur bedingt an Universitäten vertreten sind wie z.B. Soziale Arbeit und Pflegewissenschaften. Absolvent*innen klassischer HAW-Fächer ist bisher in der Regel nur die ‚fachfremde‘ wissenschaftliche Qualifizierung möglich, da die grundständige akademische Disziplin an Universitäten nicht vertreten ist.
Ein nicht zu vernachlässigender Fördereffekt für die Forschung ist der wissenschaftliche Diskurs, der im Rahmen von Promotionsverfahren initiiert wird. Grundelemente der wissenschaftlichen Qualifizierung im Rahmen der Promotionsprogramme des PK NRW sind die Einführung in die scientific community durch Publikationstätigkeiten und Teilnahmen an nationalen und internationalen Konferenzen. Die Forschung erhält Sichtbarkeit und misst sich an nationalen und internationalen Standards.
Wissenschafts- und bildungspolitisch schafft NRW optimale Bedingungen für die akademische Nachwuchsförderung und überwindet Qualifizierungsbarrieren und Diskriminierungen, die aufgrund elitärer und tradierter Institutionenzuschreibungen bestehen. Das ist ein klares Bekenntnis zur Ermöglichung von Qualifizierungschancen in einem differenzierten Hochschulsystem.
Die Diversifizierung der Qualifizierungswege für den wissenschaftlichen Nachwuchs wird zunächst auf vielen Ebenen Unklarheiten, Informationsdefizite und Erläuterungsbedarfe verursachen. Das Wissenschaftssystem kann aber damit umgehen, das hat bereits die Umstellung auf BA- und MA-Studiengänge bewiesen, so dass hier keine großen Risiken zu erwarten sind. Kurz- bzw. mittelfristig, langfristig auf jeden Fall, werden die Chancen der Veränderungen die Irritationen und Unsicherheiten überwiegen.
Für Studierende eröffnen sich neue Perspektiven und Entwicklungschancen; die Möglichkeit für oder gegen eine Promotion wird nicht bereits durch die Entscheidung für ein Studium an einer HAW oder einer Universität gefällt. Losgelöst von der Wahl einer Universität oder einer HAW kann sich im Verlauf des Studiums der Wunsch nach einer Promotion und einer wissenschaftlichen Karriere entwickeln und hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler*innen können diesen Weg verfolgen.
Das PK NRW als Repräsentant anwendungsorientierter Forschung fördert den Anteil anwendungsorientierter Promotionen und leistet einen Beitrag zum Innovationsschub für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort NRW.
Unser Thema im Januar 2021:
Nachwuchsförderung

© Klaus Altevogt
Dr. Stefan Nacke | CDU-Landtagsfraktion
Wissenschaftspolitischer Sprecher
Uns geht es um Qualität und deswegen um eine unideologische Betrachtung: Deswegen war uns wichtig, dass der Wissenschaftsrat die Güte der geplanten Maßnahmen garantiert. Leider konnten durch das bisherige Modell der „kooperativen Promotion“ die Bedarfe nicht abgedeckt werden, weil es nicht im ausreichenden Maße zu solch wünschenswerten Kooperationen zwischen Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissemschaften (HAW) gekommen ist.
Aus diesem Grunde soll das bestehende Graduiertenkolleg zu einem Promotionskolleg weiterentwickelt werden, das dann ein konditioniertes und durch das Wissenschaftsratsgutachten qualitätsgesichertes Promotionsrecht erhält. Es sind also nicht die HAW, die zukünftig promovieren, sondern das von ihnen gemeinsam getragene Promotionskolleg als eine landesweite Struktur. Das jeweils besondere Profil von HAW und Universitäten bleibt somit bestehen, zugleich aber können besonders forschungsstarke Initiativen und Projekte der HAW attraktiver für den wissenschaftlichen Nachwuchs werden.
Ich habe einen sehr guten Eindruck vom bisherigen Prozess gewonnen, den Prof. Sternberg mit seinen Mitarbeiter*innen sowohl effizient, als auch kommunikativ steuert. Wichtig ist, dass sich die verschiedenen Fachgruppen auf anspruchsvolle und lebbare Verfahren einigen – Promovierende und Betreuende -, und ich bin mir sicher, dass sich dadurch auch eine Qualitäts- und Innovationsdynamik bis in die HAW vor Ort entwickelt.
Das Promotionskolleg wird eine Marke für exzellente, angewandte Forschung sein, Absolvent*innen werden bei Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt eine große Nachfrage erleben und auch hinsichtlich Bewerbungsverfahren auf Professuren erfolgreich sein. Ich bin mir sicher, dass durch das Promotionskolleg auch der Qualitätsdiskurs bei Promotionen insgesamt profitiert, denn seine Transparenz und Standards werden Maßstäbe prägen.
Ich habe Prof. Sternberg im vergangenen Jahr dazu eingeladen das Promotionskolleg im Kreise von Kolleg*innen bei der Wissenschaftssprechertagung der CDU-Landtagsfraktionen aus ganz Deutschland in Münster vorzustellen, und wir sind auf großes Interesse gestoßen. Nordrhein-Westfalens Wissenschafts- und Hochschulpolitik hat in Deutschland einen guten Namen.
Die HAW sollten ihr besonderes Profil weiter ausbauen und den Kontakt mit regionaler mittelständischer Wirtschaft intensivieren. Außerdem sollten sie weiterhin die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen für Unternehmen im Umfeld sein. Wir haben in diesem Sinne nicht nur ein wissenschaftspolitisches, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Interesse an guter Forschung. Wichtig wäre für das Promotionskolleg, sich auch bei Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu bewerben und dadurch entsprechende Drittmittel einzuwerben.
Ich habe bei Besuchen vor Ort tolle Projekte wahrnehmen dürfen und bin mir sicher, dass das Erfolgsmodell HAW – nochmals gestärkt durch das Promotionskolleg – gerade aus seiner Regionalität heraus die wirtschaftliche Dynamik steigern wird. Und für Studierende sind die HAW ohnehin attraktiv.

© privat
Prof. Dr. Martin Sternberg | Hochschule Bochum
Professor für Physik, Vorsitzender des Graduierteninstituts NRW
Seit vielen Jahren sind Professor*innen von HAW an der Betreuung, Begutachtung und Prüfung von Promotionen beteiligt. Sie bringen diese Erfahrung in das Promotionskolleg NRW ein. Das Promotionskolleg selbst baut ein engmaschiges Qualitätssicherungssystem auf. Dazu gehört für Professor*innen, dass sie aktuelle Forschung durch referierte Publikationen und Drittmitteleinwerbung nachweisen müssen, für die Doktorand*innen, dass sie ein Promotionsprogramm mit regelmäßiger Rückkoppelung durch Fachleute durchlaufen müssen, auch in Form von Konferenzbeiträgen und Veröffentlichungen.
Die Begutachtung erfolgt durch mindestens drei qualifizierte Professor*innen, von denen eine Person extern sein muss, also weder dem Betreuungsteam noch einer der Hochschulen des Betreuungsteams angehören darf. Sowohl bei der Betreuung als auch bei Begutachtung und Prüfung sollen im Übrigen nach Möglichkeit auch Professor*innen von Universitäten beteiligt werden.
Das Qualitätssicherungssystem wird von einem wissenschaftlichen Beirat kritisch begleitet, der mindestens zur Hälfte aus Wissenschaftler*innen von Universitäten bestehen wird. Dies alles wird auch noch vom Wissenschaftsrat begutachtet. Hinsichtlich der Qualität können keine Zweifel bestehen. Durch die Zusammenarbeit der 21 Trägerhochschulen in NRW entsteht auch ein so vielfältiges und kompaktes Forschungsumfeld, dass Doktorand*innen auf höchstem Niveau forschen können.
Zunächst verbinde ich die Erwartung, dass der Aufbau des Promotionskollegs, das ja an die fünfjährige Erfahrung mit dem Graduierteninstitut NRW anknüpft, schnell abgeschlossen wird und auch die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat zügig erfolgt. Mit der Verleihung eines Promotionsrechts an das Promotionskolleg wird die Forschung an den HAW einen weiteren Schub erleben. Es wird eine Beteiligung an Programmen erfolgen, die heute noch nicht möglich ist. Für nationale und internationale Partner werden die HAW attraktiver und auch für zukünftige Studierende.
Ich denke, dass das Promotionskolleg NRW für Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Lösung ist. Es setzt eine starke Bereitschaft zur Kooperation voraus, auch über größere Distanzen innerhalb des Landes. Das dies aber auch z.B. mit Videokonferenzen und ohne viele Reisen geht, zeigt die derzeitige Gesundheitskrise. Unser Modell erfordert einen gewissen Koordinierungsaufwand über die Hochschulgrenzen hinaus, hat aber den großen Vorteil, einerseits den Promovierenden eine so große Forschungsbreite- und tiefe zu bieten, wie es einer einzelnen HAW kaum möglich ist, und andererseits über alle Hochschulen hinweg eine einheitlich hohe Qualität zu gewährleisten. Dies kann in anderen Bundesländern auch gelingen.
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in NRW haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung der Wissenschaften, vor allem aber auch für das Schaffen innovativer Lösungen im technischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Bereich liefern. Dies ist essenziell für unseren Lebensstandard, die Lebensqualität und insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes.
Die Forschung an den HAW muss einerseits strukturell gefördert werden, etwa durch den weiteren Aufbau forschungsunterstützender Strukturen, die Erweiterung des Mittelbaus und nicht zuletzt die Verleihung des Promotionsrechts an das Promotionskolleg NRW. Weiterhin sind gezielte Forschungsförderprogramme in ausgewählten Forschungsbereichen sinnvoll. Diese sollten mit der Förderung Promovierender verbunden werden.
Die Zahlen sprechen für sich. Trotz gewisser struktureller Nachteile hat der wissenschaftliche Output aus den HAW in den letzten Jahren permanent zugenommen. Dabei ist eine strikte Abgrenzung gegenüber der Forschung an Universitäten weder sinnvoll noch möglich, dennoch erfolgt die Forschung im Profil der HAW, das auch nicht nur auf die angewandte Forschung begrenzt ist. Das Forschungspotenzial der HAW kann sich aber noch deutlich weiter entfalten. Das Promotionskolleg NRW ist dabei ein wesentlicher Baustein.
Unser Thema im Oktober 2020:
Künstliche Intelligenz – Veränderungen und Visionen

© MWIDE NRW
Prof. Dr. Andreas Pinkwart | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW
Minister
Speziell mit Blick auf die Forschung lässt sich sagen, dass Deutschland über eine exzellente Ausgangslage im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens verfügt und den internationalen Vergleich sicher nicht scheuen muss. Dank zahlreicher Universitäten und Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, dem DFKI und vielen weiteren exzellenten Institutionen, weist Deutschland eine leistungsfähige Wissenschafts- und Forschungslandschaft im Bereich KI auf. Insbesondere das Industrie- und Innovationsland Nordrhein-Westfalen kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Künstlichen Intelligenz zurückblicken und stolz auf seine Vorbildfunktion sein, wenn es darauf ankommt, Wirtschaft und Forschung zu verzahnen und anwendungsorientierte KI-Forschung voranzutreiben.
In NRW wird also nicht nur exzellente Forschung betrieben, es werden KI-basierte Anwendungen entwickelt, die der internationalen Konkurrenz in nichts nachstehen und sie sogar übertreffen. Das Kölner Start-up DeepL ist z.B. führend im Bereich der Textübersetzung und das Dortmunder Unternehmen RapidMiner weist eine Erfolgsgeschichte auf, die durch die fruchtbare Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft entstanden ist.
Allerdings gibt es auch viel Nachholbedarf und es besteht ein enormer Handlungsdruck, denn die Wettbewerbssituation rund um KI ist sehr dynamisch. Viele Unternehmen in Deutschland und Europa fangen gerade erst an, sich zu orientieren und müssen sich nun baldmöglichst strategisch positionieren. KI wird zukünftig jede Branche beeinflussen – es ist daher dringend angeraten, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Wir haben in Deutschland eine gute Basis für die KI-Entwicklungen der Zukunft. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die etablierten Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und zugleich ein Umfeld geschaffen wird für neue Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle global skalieren können.
Der Mensch ist ständigen Innovationszyklen ausgesetzt, die naturgemäß Auswirkungen auf das Privat- und Arbeitsleben haben. Die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz hat dabei das Potenzial, die Prozesse in Unternehmen effizienter zu gestalten, die Qualität der Produkte zu verbessern und Kunden zielgerechter zu informieren. Eine KI-basierte Datenanalyse kann unterstützen, bessere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Bei all diesen Innovationen muss allerdings immer das Prinzip gelten, dass die Technologie für den Menschen entwickelt und eingesetzt wird. Bestimmte Tätigkeiten werden durch den Einsatz von KI unterstützt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet. Die Technologie hat das Potential, Abläufe zu verbessern, indem z. B. der Ausfall von Produktionsmaschinen vorzeitig angekündigt wird oder komplexe Informationen übersichtlich dargestellt und zur Erleichterung von Entscheidungen eingesetzt werden. Unabdingbar ist dabei, dass die eingesetzte Technologie immer vom Menschen selbst kontrolliert und gesteuert und das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zum gegenseitigen Nutzen gestaltet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die berufliche Aus- und Weiterbildung als Teil der digitalen Kompetenzerweiterung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer wichtiger und dringlicher. KI verändert jedoch nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern findet bereits heute Einzug in viele Bereiche des privaten Lebens. Auch hier muss sichergestellt werden, dass ein verantwortungsbewusster und aufgeklärter Umgang mit den intelligenten Assistenten stattfindet.
Die digitale oder auch Datenkompetenz (Data Literacy) ist schon heute über alle Bildungswege hinweg wichtig und muss weiterhin substanziell gestärkt werden. Im Hinblick auf eine mündige Nutzung von KI im Alltag und Beruf muss für Mechanismen und Grenzen der Technologie sensibilisiert werden, Kompetenzen erweitert und neue Know-how-Felder geschaffen werden.
Wie bereits angesprochen, wird Künstliche Intelligenz zukünftig jede Branche in unterschiedlichen Ausmaßen beeinflussen. Daher ist es so wichtig, sich jetzt mit KI zu beschäftigen. Neben wirtschaftlichen Potenzialen in der Produktion oder dem Finanzsektor bietet Künstliche Intelligenz auch unzählige Möglichkeiten, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit wie Klimawandel, Mobilität oder Gesundheit zu gestalten. Im Bereich Umwelt und Klima erstrecken sich die Einsatzmöglichkeiten von der Auslastungsoptimierung von Windrädern bis hin zu der Vorhersage von Umweltkatastrophen und der Steuerung von Schutzmaßnahmen. Die landwirtschaftliche Versorgung mit Grundnahrungsmitteln kann mithilfe intelligenter Systeme überwacht, Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die Technologie bietet ebenso viele Möglichkeiten im Gesundheitsbereich. Sowohl die Diagnostik von Krankheitsbildern, als auch die Dosierung von Therapiemaßnahmen, z. B. in der Krebsbehandlung können durch KI so verbessert werden, dass Patienten weniger Nebenwirkungen erleiden müssen und bessere Genesungschancen haben. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen können maßgeblich von der Unterstützung intelligenter Systeme profitieren, um etwa fehlende Sehkraft auszugleichen oder durch intelligente Prothesen mit Anbindung an das steuernde Nervensystem.
Allgemein gesprochen ist es heute noch gar nicht abschließend vorherzusehen, welche Möglichkeiten durch die Entwicklungen der KI noch entstehen werden. Klar ist jedoch, dass wir heute den Grundstein dafür legen, dass auch alle zukünftigen Entwicklungen dazu dienen, uns als Menschen zu unterstützen.
Zunächst einmal ist es grundsätzlich ein guter Mechanismus, eine neue Technologie auch zu hinterfragen, und nicht zum bedenkenlosen Einsatz in allen möglichen Bereichen überzugehen. Vor allem im Bereich der KI zeichnet uns dieses Vorgehen in Europa aus. Die bestehende Skepsis darf allerdings nicht dazu führen, dass wir die genannten Potentiale verstreichen lassen. Daher ist es wichtig, die bestehenden Vorbehalte gegenüber Künstlicher Intelligenz im Allgemeinen abzubauen und das Vertrauen in KI durch eine bessere Aufklärung zu stärken.
Europa und Deutschland verfolgen in diesem Zusammenhang das klare Ziel, mit einem menschenzentrierten Ansatz der Künstlichen Intelligenz eine nachhaltige Alternative zu den bestehenden Marktmächten zu etablieren. Von den beteiligten Akteuren fordert die EU einen verantwortungsvollen Umgang und die Entwicklung einer vertrauenswürdigen KI, um die Akzeptanz der Technologie zu gewährleisten. Relevante Aspekte sind dabei nicht nur ethische und moralische Komponenten oder die rechtlich-juristische Betrachtungen, sondern auch die Sicherheit, Verlässlichkeit, Transparenz, Fairness und Autonomie für alle Nutzergruppen im Einsatz der Künstlichen Intelligenz.
Um diese Forderungen umzusetzen, erarbeitet die Kompetenzplattform für Künstliche Intelligenz in NRW, kurz KI.NRW, und das Fraunhofer IAIS einen Prüfkatalog zur Zertifizierung von Künstlicher Intelligenz mit dem Ziel, das gesellschaftliche Vertrauen in KI-Anwendungen zu stärken. Diese deutlichen Schritte hin zu einem KI-Gütesiegel unter ethischen, rechtlichen und philosophischen Gesichtspunkten erzeugt Vertrauen, etabliert – übrigens aus NRW heraus – die Qualitätsmarke »KI Made in Germany« und unterstreicht den Anspruch, Künstliche Intelligenz menschzentriert zu denken.
Insbesondere mit Blick auf KI-Anwendungen, die an sicherheitskritischen oder sensiblen Stellen eingesetzt werden, etwa beim Autonomen Fahren oder in der Medizin, müssen Anwendungen überprüfbar konstruiert werden und ethische sowie rechtliche Rahmenbedingungen bereits beim Design erfüllen. Zusätzlich zu diesen Bestrebungen, ist es unerlässlich, einen fortlaufenden Dialog mit der Gesellschaft zu suchen und durch die Beteiligung aller, das Vertrauen in Zukunfts- und Schlüsseltechnologie weiter zu stärken.
Das zentrale Anliegen muss lauten, den Transfer der KI-Forschung in den praktischen Einsatz so zu gestalten, dass die Potentiale für unsere Wertschöpfung sowie für die beschriebenen gesellschaftlichen Herausforderungen gehoben werden können. Damit einher geht ein klarer Fokus auf die Einhaltung unserer geltenden europäischen Werte wie Selbstbestimmung, (Daten)-Sicherheit und Transparenz, so dass die Anwenderinnen und Anwender im beruflichen wie im privaten Kontext auf die Technologie vertrauen können. Auf dem Weg dorthin werden in Deutschland und Europa die Kräfte gebündelt, um den menschenzentrierten Einsatz der Künstliche Intelligenz zu stärken und damit ein weltweites Signal in Richtung der technologischen Entwicklungen zu senden.
Die bereits angesprochene Initiative zur Entwicklung und Zertifizierung von vertrauenswürdiger KI ist hierbei ein wichtiger Baustein, um den Vorbehalten und der Skepsis auf diesem Weg zu begegnen. Durch einen interdisziplinären Austausch zwischen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Machine Learning, Philosophie, Rechtsprechung sowie Regulierung und Prüfung wird ein Standard geschaffen, der technisch zuverlässige und ethisch verantwortungsvoller KI-Anwendungen ermöglicht. Dazu wird ein Prüfkatalog („Bonner Katalog“) entwickelt und anhand verschiedener Use-Cases getestet, mithilfe dessen sachverständige Dritte eine Zertifizierung von KI-Systemen vornehmen können.
Einen weiteren wichtigen Beitrag auf dem Weg zu Innovation durch KI stellt auch das Projekt GAIA-X dar, welches den Zugang zu einer sicheren europäischen Digitalinfrastruktur ermöglicht und in Zusammenarbeit mit der International Data Spaces Association eine Struktur zum souveränen Datenmanagement und Austausch von Daten für KI-basierte Geschäftsmodelle etabliert. So wird die Grundlage für ein branchenübergreifendes, digitales und europäisches Ökosystem geschaffen, um gegenüber weltweiten (Plattform-)Konkurrenten wieder einen sicheren Stand einnehmen zu können.
Die strategische Ausrichtung der EU und der Mitgliedstaaten zeigt deutlich, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang fordern und diesen auch in Wirtschaft und Gesellschaft verankern wollen. Eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten ist in diesem Prozess unabdingbar und so sollten sich lokale Akteure zunehmend vernetzen und zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.

© Prof. Dr. Hendrik Wöhrle
Prof. Dr. Hendrik Wöhrle | Fachhochschule Dortmund
Professor für Intelligente autonome Sensor- und Aktor-Systeme
Deutschland hat in der Vergangenheit wichtige Pionierarbeit im Bereich der KI geleistet. Aktuell ist die Situation jedoch etwas problematisch. Vor allem durch die großen Digitalkonzerne wird z.B. in den USA, in den letzten Jahren auch in China, wesentlich stärker in die KI investiert. Darüber hinaus wird derzeit auch die Forschung im Bereich KI vorrangig von diesen Ländern dominiert, insbesondere in dem gegenwärtig wichtigsten Themengebiet des maschinellen Lernens und der Neuronalen Netze. In Deutschland findet die KI momentan einen immer größeren Eingang in die Wirtschaft, was eine wichtige Entwicklung ist. Deutschland steht zwar insgesamt nicht so schlecht da, es könnte gemessen an seinem akademischen und wirtschaftlichen Potential jedoch eine wichtigere Rolle spielen, als es derzeit tut.
Die KI ermöglicht es, auch komplexere Tätigkeiten zu automatisieren, die bisher dafür nicht in Frage kamen. Durch die KI können sogar Tätigkeiten übernommen oder effizienter gestaltet werden, die ein gewisses Maß an Intelligenz voraussetzen. Dies kann wesentliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt in fast allen Bereichen haben. Es gibt jedoch auch Bereiche, die sich kaum oder niemals durch KI-Systeme ersetzen lassen, etwa wenn der soziale Umgang und zwischenmenschliche Beziehungen wichtig sind. Ob es dann insgesamt zu einem Verlust an Arbeitsplätzen kommt oder sogar neue, insbesondere qualifizierte, Arbeitsplätze entstehen, ist umstritten. Hier kommt es darauf an, wie die Politik den Rahmen für den Einsatz von KI-Systemen gestaltet. Fakt ist jedenfalls, dass die Bedeutung von Bildung und auch Weiterbildung immer wichtiger werden, damit sich auch Schüler*innen und Studenten*innen zukünftig mit dem Thema auskennen und Arbeitskräfte sich an die sich ändernden Anforderungen in der Arbeitswelt anpassen können.
Eine neue Entwicklung ist, dass KI vermehrt nicht nur auf leistungsstarken Rechnern oder in einer Cloud eingesetzt wird, sondern „vor Ort“: lokal in einem technischen System, beispielsweise einem Roboter, Automobil oder medizintechnischem System. Dies erlaubt es, dass Daten nicht über das Internet übertragen werden müssen, so dass die KI schnell reagieren und Entscheidungen treffen kann. Außerdem können Daten so besser vor ungewolltem Zugriff geschützt werden. Dazu muss die Hardware, auf der die Berechnungen für die KI durchgeführt werden, jedoch sehr kompakt und energieeffizient, aber trotzdem für die KI-Algorithmen schnell genug sein. Dass kann z.B. durch Spezialprozessoren ermöglicht werden. Dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für eine KI, die in technische Systeme eingebettet ist. Dies erlaubt, dass Roboter wesentlich intelligenter als bisher agieren können, dass medizintechnische Geräte genauer werden und sich an ihre Benutzer anpassen oder dass Geräte rechtzeitig selber erkennen können, dass sie bald eine Fehlfunktion aufgrund von Verschleiß erleiden und ersetzt werden müssen. Neben der Robotik und Medizintechnik wird dies auch in vielen anderen Bereichen dazu führen, dass sich die KI dort besser einsetzen lässt, etwa im Maschinenbau oder der Mobilität. Insbesondere für die technisch geprägte mittelständische deutsche Wirtschaft kann ein solcher Ansatz einen wesentlichen Effizienzgewinn und großen Vorteil bedeuten.
Hier gibt es meist mehrere wesentliche Befürchtungen in der Bevölkerung, die sehr unterschiedliche Ursachen haben. Eine sehr dystopische Befürchtung ist, dass eine KI ein Bewusstsein und einen eigenen Willen entwickelt und dann die Herrschaft übernimmt. Von einer solchen „Superintelligenz“ ist die heutige Wissenschaft jedoch sehr weit entfernt, und es ist umstritten, ob so etwas überhaupt jemals möglich sein wird. Wer jedoch versteht, wie die heutige KI funktioniert, betrachtet ein solches Szenario nicht mehr als realistisch. Durch eine entsprechende Ausbildung und das Bemühen, KI allgemeinverständlich zu erklären, können diese Ängste genommen werden. Eine weitere Befürchtung ist, dass die Daten, welche für die Nutzung der KI notwendig sind, nicht ausreichend geschützt werden. Insbesondere für die Techniken des maschinellen Lernens spielt der Datenschutz also eine wichtige Rolle. Dieser muss gewährleistet werden, was nur durch entsprechende Regulierungen, europäische KI-Initiativen und die „lokal operierenden KI-Systeme“ erreicht werden kann. Es bedarf hier also entsprechender Regeln, neuer Techniken und großer Transparenz.
Künstliche Intelligenz ist wie ein Werkzeug zunächst weder etwas Gutartiges noch Bösartiges. Es ist jedoch wichtig darauf hinzuwirken, dass das „Werkzeug KI“ so eingesetzt wird, dass die KI der Gesellschaft dient und den Menschen hilft und sie unterstützt. Hierbei ist es wichtig, auf ethisch vertretbare und sozialverträgliche Verwendungsweisen wertzulegen und ein entsprechendes rechtliches Rahmenwerk zu schaffen. Dazu ist insbesondere weitere Forschung wichtig, um genau verstehen und erklären zu können, wie KI-Systeme ihre Entscheidungen treffen, was insbesondere bei Neuronalen Netzen noch schwerfällt.
Um international nicht den Anschluss im Bereich KI-Forschung zu verlieren, wird weitere Förderung für die Forschung benötigt. Aktuelle Forschungsprogramme müssen verstetigt und ausgebaut werden. Außerdem müssen Entwicklungen der Forschung in die Wirtschaft transferiert werden, etwa durch verstärkte Unterstützung von entsprechenden Firmengründungen. Außerdem ist es wichtig, dass sich Deutschland europäische Partner sucht, die sich ebenfalls grundsätzlich an einer dem Gemeinwohl dienenden Nutzung der KI orientieren und dazu entsprechende europäische Initiativen anregen.
Unser Thema im August 2020:
Neue Chancen durch Telemedizin
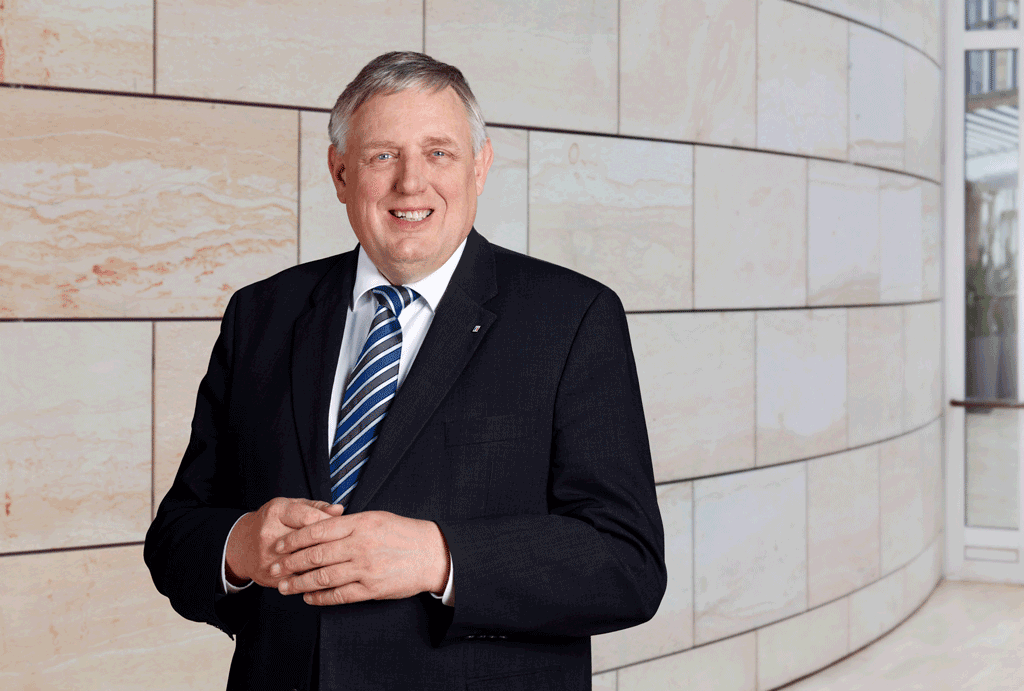
© MAGS NRW
Karl-Josef Laumann | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Minister
Telemedizinische Anwendungen kommen bereits heute in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie bei der ärztlichen Entscheidungsberatung zum Einsatz. Die Telemedizin kann sowohl Ärzte wie auch nicht-ärztliches medizinisches und pflegerisches Personal bei Ihrer Arbeit unterstützen. Beispielsweise ermöglichen Telekonsile die schnelle Verfügbarkeit fachärztlicher Expertise in der Hausarztpraxis und die Videosprechstunde hilft Patienten Anfahrtswege zu sparen, was bei immobilen Patienten oder auch nach Operationen eine sinnvolle Hilfestellung sein kann. Auch für psychotherapeutische Gespräche müssen Patienten nicht jedes Mal in die Praxis kommen. Möglich ist auch Verknüpfung von Videokonferenzen mit einer elektronischen Übertragung von Vitalwerten zwischen Arzt und nicht-ärztlichem Personal oder Pflegefachkraft, um die Qualität von Hausbesuchen oder im Pflegeheim zu verbessern.
Einige Leistungen, wie Videosprechstunden zwischen Arzt und Patient, Videofallkonferenzen mit Pflegekräften in Heimen aber auch in der Häuslichkeit des Patienten und ausgewählte telekonsiliarische Befundbeurteilungen werden bereits heute von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Die Landesregierung hat die Bedeutung der Telemedizin für die medizinische Versorgung im Land frühzeitig erkannt. Deshalb fördern wir beispielsweise seit vergangenem Jahr die Hard- und Software-Ausstattung von Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen mit zwei Millionen Euro pro Jahr. Damit geben wir einen Impuls in die Versorgungslandschaft.
Daneben habe ich das Virtuelle Krankenhaus ins Leben gerufen. Seit Herbst vergangenen Jahres arbeiten Experten aus der Selbstverwaltung, Kliniken und den Kassen gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium am Aufbau dieser innovativen und bundesweit einmaligen Einrichtung. Wir machen damit die medizinische Exzellenz in unserem Land für alle Krankenhäuser und deren Patienten verfügbar. In der Hochphase der Corona-Pandemie hat das Virtuelle Krankenhaus bereits im Pilotbetrieb seinen Nutzen bewiesen: Schwerst erkrankte Patienten konnten telemedizinisch betreut werden und von der Expertise der Universitätskliniken Aachen und Münster profitieren. Das ersparte unter anderem belastende Verlegungen und hat Leben gerettet.
Telemedizinische Anwendungsszenarien
Telemedizinische Konsile und Videosprechstunde
Mithilfe telemedizinischer Konsile können Ärzte ortsunabhängig auf die Expertise ausgewiesener Spezialisten, zum Beispiel aus Universitätskliniken, zurückgreifen. Patienten mit unbekannter Diagnose, seltenen Krankheiten oder komplizierten Krankheitsverläufen kann so schneller geholfen werden. Sie müssen in der Regel weite Wege zu Spezialisten auf sich nehmen oder viele verschiedene Fachärzte konsultieren, bis sie Hilfe erhalten. Videosprechstunden können Patienten auch direkt einen niederschwelligen Zugang zu ihrem Hausarzt oder auch zu Fachärzten bieten.
Telekonsile können sinnvoll unterstützt werden, indem alle an der Behandlung beteiligten Ärzte – die Zustimmung des Patienten vorausgesetzt – über eine gemeinsame elektronische Akte, wie zum Beispiel die elektronische Fallakte (EFA), auf alle behandlungsrelevanten Daten zugreifen. Insbesondere in der Palliativversorgung und in Hospizen, wo es sich meist um multiprofessionelle Versorgungsteams aus spezialisierten Ärzten und Pflegekräften, oftmals unter Beteiligung der Angehörigen, handelt, können Telekonsultationen wesentlicher Bestandteil des Versorgungsprozesses sein. Aufgrund der Schwere der Erkrankung ist das Behandlungsteam besonders auf eine orts- und zeitunabhängige Kommunikation und eine lückenlose Datenbereitstellung angewiesen.
Telemedizinische Konsile können von Ärzten bisher nur sehr begrenzt abgerechnet werden.
Telemedizinisch gestützte Delegation
Delegierbare Aufgaben, die durch entsprechend qualifiziertes nicht-ärztliches Personal erbracht werden, können durch eine Videovisite des Arztes ergänzt werden. Wenn zusätzlich Vitalwerte der Patienten aus der häuslichen Umgebung (z. B. EKG oder Blutzuckerwerte) direkt in die Arztpraxis übertragen werden, kann der behandelnde Arzt bei Bedarf ohne weiteren Zeitverzug Maßnahmen vor Ort anordnen. Wenn die beim Patienten erfassten Vitaldaten auch noch direkt in das Praxisinformationssystem übertragen werden, liegen dem Arzt strukturierte Informationen direkt in seiner Patientenakte vor, wodurch sich eine von Übertragungsfehlern befreite Verlaufsdokumentation ergibt. Gleichzeitig verringert sich der Übertragungs- und Dokumentationsaufwand erheblich.
Stand heute werden noch kaum Komplettlösungen angeboten, die ein Vorgehen, wie oben beschrieben, ermöglichen. Die Anbindung der medizintechnischen Geräte, wie Waage, Blutzuckermessgerät etc. an das IT-System der Arztpraxis ist aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Systeme aufwändig und wird aufgrund der fehlenden Refinanzierungsmöglichkeiten von den Herstellern bisher kaum umgesetzt.
Elektronische Visite in der Pflege
Die elektronische Visite in Pflegeheimen oder auch die Konsultation des Arztes durch den ambulanten Pflegedienst kann für die Patienten belastende Transporte in die Arztpraxis oder gar vorschnelle Krankenhauseinweisungen vermeiden. Gleichzeitig kann eine engere ärztliche Begleitung sichergestellt und damit die Versorgung verbessert werden. Auch hier können neben der Videokonferenz zusätzliche Geräte zur Erfassung von Vitaldaten, wie Blutdruck, Blutzuckerspiegel oder EKG ergänzend zum Einsatz kommen.
Obwohl bereits Vergütungsmöglichkeiten existieren, werden sie in der Praxis bisher kaum genutzt.
Die Videosprechstunde ist nur ein einfaches Beispiel für die Vorteile, die die Telemedizin bieten kann – immer in Ergänzung zur klassischen medizinischen Versorgung. Die Videosprechstunde erlebt durch die derzeitige Coronaviruskrise neuen Aufschwung, weil sie Patienten mit Virus-Symptomen ermöglicht, den Gang zum Arzt zu vermeiden und stattdessen zunächst digital mit dem Arzt in Kontakt zu treten. Durch die Videosprechstunde kann sich der behandelnde Arzt einen umfassenden Eindruck zum Gesundheitszustand verschaffen und schon per Fernbehandlung weiterhelfen.
Damit hat die Videosprechstunde das Potenzial, die Verbreitung des Virus verlangsamen und gleichzeitig schützt sie andere Patienten – insbesondere chronisch und ernsthaft Erkrankte – und auch das medizinische Personal vor einem unnötigen Infektionsrisiko.
Telemedizin als Ergänzung und Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung kann in vielen anderen Bereichen unterstützen. Ein großer Vorteil ist vor allem die Geschwindigkeit, die eine Echtzeit-Übertragung von bspw. Bilddaten, aber auch anderen Informationen ermöglicht. Ob fachärztlicher Austausch oder digitale Krankschreibung und e-Rezept – solange die Anwendungen einen direkten Nutzen für den Patienten haben, sehe ich große Vorteile im technischen Fortschritt.
Siehe Antwort Frage 2.
Eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einsatz telemedizinischer Anwendungen auf Patientenseite ist die leichte Bedienbarkeit der Geräte, gerade für ältere Menschen. Diese Menschen hatten bisher nur relativ wenige Berührungspunkte mit solchen Geräten. Gerade bei chronisch Kranken ist das wichtig, die entsprechende Geräte selbstständig zuhause nutzen sollen. Die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen, z.B. Schwierigkeiten beim Sehen, Hören oder bei der Fingerfertigkeit, müssen deshalb bei der Gestaltung der Anzeigen und Bedienungselemente berücksichtigt werden. Der Markt entwickelt sich allerdings rasant und geht in vielen Anwendungen zielgruppengerecht auf den Bedarf ein.
Die nötige Bandbreite ist inzwischen zumindest bei den nordrhein-westfälischen Kliniken nahezu flächendeckend vorhanden, insofern sind die Herausforderungen für den ländlichen Raum in dieser Hinsicht überschaubar. Die Menschen im ländlichen Raum profitieren allerdings sehr davon, wenn ihr Hausarzt schneller verfügbar ist, die Möglichkeit eines Hausbesuchs per Televisite bietet und auf die Expertise in unterschiedlichsten Fachgebieten landesweit zugreifen kann.
Wichtiger sind hier einheitliche Standards. Telemedizin bedeutet die Anwendung von Kommunikationsmitteln und beinhaltet damit die Anforderung von Interoperabilität zwischen den Kommunikationspartnern, das heißt, Sender und Empfänger müssen auch miteinander arbeiten können.

© FH Dortmund
Prof. Dr. Britta Böckmann | Fachhochschule Dortmund
Professorin für Medizinische Informatik
Für Patient*innen sind die Möglichkeiten, Telemedizin zu nutzen, sehr beschränkt. Da die meisten niedergelassenen Haus- und Fachärzte sich wenig auskennen und die wenigsten bislang an telemedizinischen Programmen teilnehmen, ist es schwer, überhaupt an gute Informationen zu kommen. Eine Ausnahme bilden telemedizinische Anwendungen, die rein auf einer App basieren, diese werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen teils propagiert und demnächst über das Register beim BfArM auch zur Verschreibung durch Ärzt*innen zur Verfügung stehen. Ein Beispiel mag den Zustand illustrieren – ob ein Patient mit Herzinsuffizienz von der Möglichkeit des Telemonitorings erfährt, hängt davon ab, bei welcher Versicherung er ist, wo er wohnt und zu welchem Arzt er geht.
Ärzt*innen im ambulanten Bereich können Videosprechstunden anbieten, die meisten telemedizinischen Programme erfordern jedoch intersektorale Kooperationen. Im stationären Bereich haben sich einige wenige Anwendungen wie Teleradiologie und Schlaganfallnetzwerke durchgesetzt.
Ein großer Vorteil der Telemedizin liegt in der ortsunabhängigen Verfügbarkeit medizinischen Wissens. So kann fachärztliche Expertise auch in dünn besiedelten Landstrichen zur Verfügung stehen, universitäre Kompetenz im ganzen Land verteilt werden, wie wir am virtuellen Krankenhaus und der Corona-Sprechstunde sehen. Mit Telemedizinzentren, die 24/7 auch Patienten zur Verfügung stehen, könnten darüber hinaus auch die Notaufnahmen entlastet werden. Es gibt ausreichend Studien, die zeigen, dass z.B. Telemonitoring bei Herzinsuffizienz nicht nur Hospitalisierung vermeiden kann, sondern auch überleben verbessert. Generell ist aus meiner Sicht wichtig, Telemedizin als sinnvolle Ergänzung, nicht Ersatz der Präsenzmedizin zu verstehen.
Videosprechstunden können auch hier einen Teil der Medizin ohne Ansteckungsrisiko verfügbar machen, ebenso wie telemedizinische Betreuungskonzepte von Pflegeheimen, wie es z.B. Dr. med. Irmgard Landgraf in Berlin schon seit Jahren praktiziert. Gerade bei älteren und möglicherweise eingeschränkten Patienten sind aber auch Grenzen des Verständnisses und der sog. „digital literacy“ zu berücksichtigen, sie müssen in solchen virtuellen Kontakten gut begleitet werden – von Angehörigen oder Pflegepersonal.
Neben den schon oft genannten technischen Voraussetzungen (flächendeckende ausreichende Bandbreite des Internets, Telematik-Infrastruktur für sicheren Datentransfer) möchte ich besonders zwei weitere Punkte ansprechen. Telemedizin passt oft nicht in unser stark sektoral ausgerichtetes und selbstverwaltetes Gesundheitswesen, da die Versorgungskonzepte oft intersektoral sind und auch den Patienten zuhause einbeziehen. Wir brauchen dafür neue andere Vergütungsstrukturen und eine Infrastruktur, die Telemedizinzentren mit 24/7-Betrieb einbezieht, so dass z.B. Videosprechstunden nicht nur zu normalen Sprechzeiten der Ärzte zur Verfügung stehen. Zum zweiten krankt die Verbreitung von Telemedizin an mangelnder Ausbildung und Information. Telemedizin gehört regelhaft in das Medizinstudium, es sollte eine Verpflichtung zur Weiterbildung geben und gute breit gestreute Informationen für Patient*innen.
Unser Thema im April 2020:
Stärken und Perspektiven der HAW
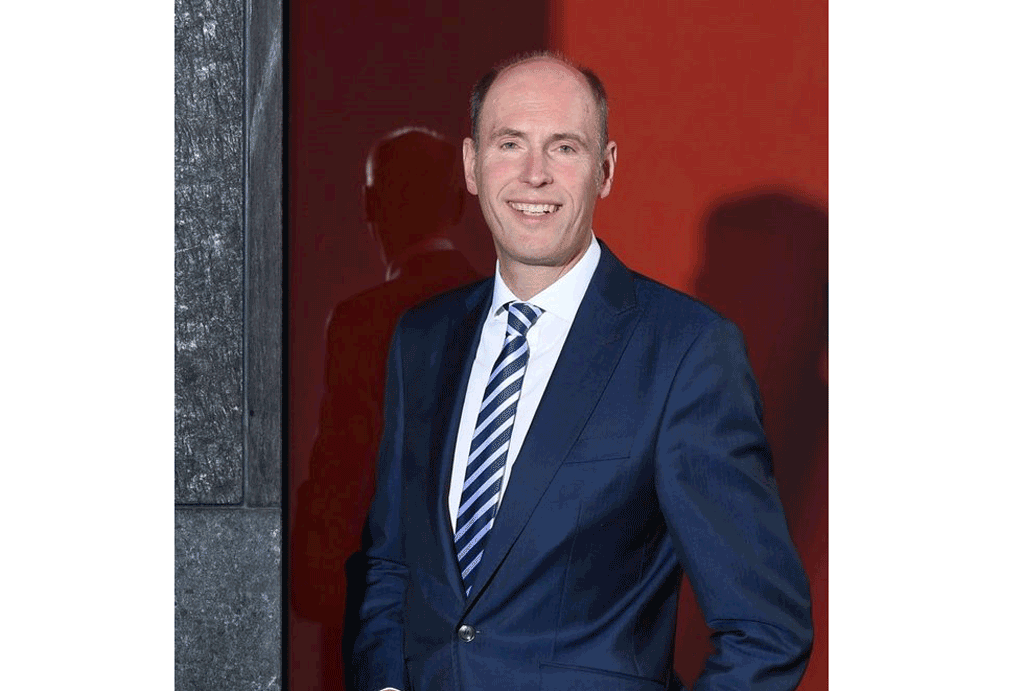
© HRK/David Ausserhofer
Prof. Dr. Peter-André Alt | Hochschulrektorenkonferenz
Präsident
Im Vordergrund steht der profilgebende Praxis- und Anwendungsbezug, der Lehre und Forschung bestimmt. Im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess haben die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wachsende Verantwortung für die akademische Lehre übernommen. Der Ausbau der Studierendenzahlen von 600.000 (2008) auf 1 Mio. (2018) unterstreicht das auf eindrucksvolle Weise. Im Bereich der Lehre ist das besondere Engagement der HAW bei der Akademisierung von Ausbildungsberufen, bei Dualen Studiengängen und wissenschaftlicher Weiterbildung hervorzuheben. Für den Forschungssektor wäre vornehmlich der Wissens- und Technologietransfer in die Praxis zu nennen. Viele HAW sind Innovationsmotoren für ihre jeweilige Region, bilden einen wichtigen Standortfaktor und leisten entscheidende Beiträge für die unternehmerische Gründungskultur.
Große Bedeutung für das zukünftige Studiengangsportfolio hat der Ausbau der Gesundheitswissenschaften. Im Blick auf die künftige Rekrutierung von Professorinnen und Professoren ist die Etablierung eines akademischen Mittelbaus erforderlich (Beispiele Berlin, Hessen). Regionalverbünde und Kooperationsmodelle mit Universitäten, darunter auch zum Zweck kooperativer Promotionen, sind zu intensivieren. Neue Forschungsschwerpunkte im Bereich der Sozialen Arbeit/Gesundheit dürften sich herausbilden. Langfristig wird es um eine Intensivierung internationaler Kooperationen gehen, auch mit Blick auf die Globalisierung des Forschungs- und Bildungssektors insgesamt.
HAW leiden, wie andere Hochschultypen auch, unter struktureller Unterfinanzierung. Grundsätzlich ist eine aufgaben- und leistungsangemessene Finanzierung nachhaltig sicherzustellen. Der Aufwuchs der Studierendenzahlen und zusätzliche Aufgaben (Mittelbau, Ausbau Gesundheitswissenschaften) müssen adäquat und verstetigt finanziert werden; zusätzliche Leistungserwartungen erfordern zusätzliche, jeweils angemessene Mittel. Zweckmäßig für die HAW ist eine auf Komplementarität der Aufgaben- und Leistungsprofile in den Ländern abzielende Landesentwicklungsplanung. Finanzierungsmodelle und finanzielle Anreizsetzung müssen auf die Vielfalt der Profile abgestimmt und mit differenzierten Steuerungsmodellen verzahnt werden. Geboten ist eine Bündelung der Förderprogramme für angewandte Forschung und Transfer unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach. Eine große Herausforderung bedeutet der gewachsene Weiterbildungsbedarf insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Aufgrund ihres Fächerprofils könnten die HAW hier wichtige Beiträge leisten, jedoch erfordert das eine angemessene Aufstockung der Etats.
Grundsätzlich gilt, dass das deutsche Hochschulsystem mit dem Modell der funktionalen Differenzierung gut gefahren ist. Daraus ergibt sich, dass unterschiedliche Bedarfe mit entsprechend differenzierten Fördermechanismen abgesichert werden müssen.

© FH Aachen, Arnd Gottschalk
Prof. Dr. Marcus Baumann | Landesrektor_innenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften e.V.
Präsident
Die Besonderheit der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften steckt schon in ihrem Namen: Wir schreiben die Anwendungsorientierung in Lehre und Forschung groß. Wer bei uns studiert, erhält eine wissenschaftliche Ausbildung mit vielen Praxisbezügen. Wer bei uns forscht, versucht Erkenntnisse der Theorie für die Anwendung in der Praxis nutzbar zu machen und so unmittelbar zur Entwicklung technischer und sozialer Innovationen beizutragen. Professorinnen und Professoren an HAWs haben vor ihrer Lehrtätigkeit außerhalb der Hochschule in der Wirtschaft und Industrie Praxiserfahrung gesammelt zum Beispiel in der Entwicklung, im Management, meist auch in leitender Position. Sie kennen somit den Gegenstand ihrer Lehre aus unmittelbar eigener Anschauung und Tätigkeit. Darüber hinaus pflegen wir in den HAWs gerade zu kleinen und mittelständischen Unternehmen zahlreiche Kontakte und Kooperationen. Den Transfer zwischen Theorie und Praxis begreifen wir als eigenständige zentrale Leistungsdimension unserer Hochschulen. Das drückt sich unter anderem in starken Strukturen wie Transferagenturen oder der Unterstützung von Gründerinnen und Gründern aus. Gleichzeitig sind HAWs wissenschaftliche Einrichtungen mit uneingeschränkt hohem Anspruch an die Einhaltung der Standards akademischer Lehre und Forschung.
Beim massiven Ausbau der Studienplätze in den letzten Jahren im Rahmen der Hochschulpakte haben HAWs einen großen Teil der Lasten geschultert. Unser Hochschultyp erfreut sich bei Studieninteressierten und Studierenden wachsender Beliebtheit, was sicherlich auch auf die große Praxisnähe des Studiums an unseren Hochschulen zurückzuführen ist. Gleichzeitig haben die HAWs aber auch kontinuierlich ihre Forschungsleistung gesteigert. Trotz hoher Lehrdeputate von 18 Semesterwochenstunden und einem weitgehend fehlenden akademischen Mittelbau forschen Professorinnen und Professoren an HAWs sehr intensiv. Dabei steht das Ziel der Anwendung und damit des Nutzens für die Gesellschaft im Mittelpunkt. Die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung setzt ein hohes Maß an Interdisziplinarität voraus, die HAWs besonders gegeben ist.
Forschung an HAWs hilft also dabei, eine wesentliche Lücke im deutschen Innovationssystem zu schließen, die zwischen einer sehr solide ausgestatteten Grundlagenforschung vornehmlichen an den Universitäten und vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und einer bislang nur stiefmütterlich geförderten anwendungsorientierten Forschung und Innovationsentwicklung klafft. Der Aufbau einer systematischen, wissenschaftsgeleiteten Finanzierung dieser Art von Forschung an HAWs, die bislang fehlt, wäre daher ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des deutschen Innovationssystems insgesamt. Denn nur wenn die Innovationskette von der ersten Idee/Erfindung/Erkenntnis bis zum fertigen Produkt oder Verfahren vollendet ist, ergibt sich ein volkswirtschaftlicher Nutzen.
Neben Grundmitteln für die Forschung schwebt uns eine auf anwendungsorientierte Forschung ausgerichtete Deutsche Transfergemeinschaft (DTG) vor, die vergleichbar mit der DFG nach wissenschaftsgeleiteten Kriterien und unabhängig von rein unternehmerischen Interessen die Entwicklung von sozialen und technologischen Innovationen fördert. Dabei geht es nicht um einen Schutzraum für HAWs. Auch Technische Universitäten würden von einer solchen Förderstruktur profitieren und nicht zuletzt auch die in Transferprojekten mit den Hochschulen kooperierenden Unternehmen. Beides zusammen – Grundfinanzierung für Forschung an HAWs und die Schaffung der DTG – würde nicht nur eine Stärkung der Hochschulen, sondern eben auch eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts, dessen Rückgrat die kleinen und mittleren Unternehmen sind, zur Folge haben. Daher unterstützt beispielsweise auch der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) unsere Forderung nach einer DTG.
Auf das Hochschulrecht bezogen gibt es erfreuliche Entwicklungen, die dem Hochschultyp HAW neue Perspektiven eröffnen. Zu nennen ist hier zuallererst, dass es in vielen Bundesländern Bewegung beim Promotionsrecht gibt. NRW macht sich derzeit auf den Weg, die Weichen für ein Promotionskolleg der HAWs zu stellen, das mit einem eigenständigen Promotionsrecht ausgestattet sein soll. Das ist ein wichtiger Schritt, weil er endlich anerkennt, dass an unseren Hochschulen wirklich uneingeschränkt wissenschaftlich gearbeitet wird. Diese Zweifel sät der eine oder die anderen ja leider immer noch im Verteilungswettbewerb der Hochschulen und Hochschultypen um knappe Ressourcen. Darüber hinaus müssen wir als HAWs immer wieder auf die Besonderheiten unserer Hochschulen hinweisen, die zum Teil historisch bedingt sind, zum anderen Teil aber auch etwas mit unserem spezifischen Profil zu tun haben. Dass es Universitäten und HAWs in unserem Land gibt, ist gut und richtig. Es macht die besondere Stärke unseres Hochschulsystems aus.
Unser Thema im Februar 2020:
Cybersicherheit

© Telekom Deutschland
Dirk Backofen | Telekom Security
Bereichsleiter
Wir sehen derzeit, wie sich die unterschiedlichen Effekte der Digitalisierung der Gesellschaft auf unser Leben auswirken. Viele Menschen gehen sehr offen mit den neuen Möglichkeiten um, die sich uns allen bieten. Dadurch entsteht eine frische, positive Dynamik, die aber leider auch Begehrlichkeiten weckt. Kriminelle nutzen immer professioneller digitale Medien, um sich zu bereichern. Bedrohungen, wie das Emotet-Ökosystem, sind ein aktuelles Beispiel dafür. Es steht etwa für Erpressung, Identität- und Daten-Diebstahl, ist modular, flexibel und jeder von uns kann damit in Kontakt kommen. Leider schützen sich Privatpersonen, Behörden und Unternehmen viel zu selten wirkungsvoll gegen diese Gefahren. Es herrscht eine gewisse Naivität, die es Kriminellen leicht macht. Zu leicht für meinen Geschmack und deshalb engagiere ich mich für Aufklärung und besseren Schutz. Unsere Sensoren erfassen momentan im Schnitt 42 Millionen Angriffe pro Tag, in der Spitze bis zu 60 Millionen – das kann man einfach nicht ignorieren.
Welche Rolle können die Hochschulen für angewandte Wissenschaften beim Thema Cyber Security spielen?
So sehr Exzellenz in Forschung und Lehre auch wünschenswert ist – mehr als 90 Prozent aller Studierenden insgesamt zieht es später in die Wirtschaft. Je praxisnäher ein Studium grundsätzlich ist, desto schneller sind Absolventen zu integrieren und bereit für herausfordernde Aufgaben. Nähe zur Wirtschaft für einen optimalen Austausch ist daher eklatant wichtig für Hochschulen. Nur so kommen aktuellste Themen frühzeitig ins Curriculum. Hochschulen für angewandte Wissenschaften suchen diese Praxisnähe in der Regel vorbildlich und leisten damit einen wichtigen Beitrag, um den strukturellen Fachkräftemangel in Deutschland abzumildern. Wir fördern diesen Austausch als Deutsche Telekom AG von je her, gerade im MINT-Bereich.
Initiativen, wie das Cyber Security Cluster Bonn, können eine wertvolle Plattform sein. Dort agieren unterschiedliche Akteure gemeinsam, tauschen sich aus und schaffen Synergien. Ich würde aber nicht nur auf die Studierenden schauen. Die Frage ist, wie ich Lehrstühle quasi hybrid als Mitglied in Cybersecurity-Projekte der Wirtschaft integrieren kann. Können diese so flexibel sein, wie es das Tagesgeschäft und der Innovationsdruck durch technische Neuerungen auf unserer Seite erfordert – ohne, dass die Lehre darunter leidet? Daran müssen wir uns wohl im Einzelfall herantasten. Eine pauschal gültige Lösung sehe ich nicht, bin aber offen für Experimente.
In zehn Jahren werden wir bundesweit und auf europäischer Ebene viel enger zusammenarbeiten, als heute noch zum Teil. Eine Digitale Sicherheitsunion hat sich etabliert, die den wirksamen Schutz unserer Bürger, Unternehmen und Werte auf ihrer Agenda hat. Die Gesellschaft hat ein Stück weit gelernt, sich nicht nur vor Einbruch und Sonnenbrand, sondern auch vor digitalen Gefahren aktiv zu schützen. Cyber Security ist dann eine Selbstverständlichkeit, die ihren Preis hat, aber als unverzichtbare Basis jeglicher digitalen Aktivitäten wahrgenommen wird. Zwar gibt es immer noch Millionen von Angriffsversuchen pro Tag auf potentielle Schwachstellen. Diese sind mittlerweile aber eher lästig, so wie Spam-Mails. Das allgemeine Sicherheitsniveau ist besser geworden und daher fühlen wir uns subjektiv sicherer. Dazu hat das Cyber Security Cluster Bonn in nicht unerheblicher Art und Weise beigetragen.

© C. Belzer
Prof. Dr. Hartmut Ihne | HS Bonn-Rhein-Sieg
Präsident
Beiratsmitglied HN NRW
Zunächst stellt es überhaupt eine Herausforderung dar, die mit der Cybertechnik verbundenen Innovationen und Chancen angemessen zu erkennen und zu nutzen. Dabei ist der digitale Wandel in der Gesellschaft so zu gestalten, dass die Potentiale auch allen zu Gute kommen. Des Weiteren müssen erkennbare Risiken angemessen verstanden werden, damit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft klug damit umgehen können. Außerdem ist es wichtig, dass alle Schutzrechte, die den Individuen als Mensch, Staatsbürger und Verbraucher zustehen, auch in der digitalen Welt realisiert werden.
Welche Rolle können die Hochschulen für angewandte Wissenschaften beim Thema Cyber Security spielen?
Aktuell und in Zukunft haben wir einen sehr hohen Bedarf an Fachkräften mit Expertenwissen auf dem Gebiet der Cyber Security. Daher müssen wir weitaus mehr Studierende mit entsprechender Spezialisierung ausbilden. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften erfahren Studierende ein exzellentes und praxisnahes Studium, auch in Kooperation mit Unternehmen und Behörden, wodurch sie sehr schnell in der Praxis einsatzfähig sind. Zudem haben Hochschulen für angewandte Wissenschaften bereits in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie schnell und flexibel relevante Bedürfnisse der Gesellschaft und der Märkte in ihren Lehrangeboten sowie in ihren Forschungs- und Transferschwerpunkten aufnehmen und dadurch gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden.
Wir müssen noch besser strukturierte Wegebeziehungen zueinander aufbauen, d. h. es muss eine noch engere Verzahnung zwischen Hochschulen und der Praxis auf allen Ebenen, also bei Lehrenden, Studierenden und Forschenden, geben. Dafür braucht es auch programmatische Unterstützung der Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, z. B. durch gezielte Förderprogramme. Wichtig ist, dass die Hochschulen ihre Kompetenzen im Bereich Cyber Security auch für die regional angesiedelten Unternehmen sichtbarer machen. Ein Beispiel dafür ist das Lernlabor Cybersicherheit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, welches wir zusammen mit einem Fraunhofer-Institut (FKIE) betreiben. Zudem planen wir entsprechende weitere Studienangebote.
Heutzutage werden Infrastrukturen, Produkte und IT-Sicherheit in der Öffentlichkeit häufig noch separiert wahrgenommen. Allerdings können die meisten neuen Geräte im Haushalt, man mag etwa an Smart-TVs oder Kaffeemaschinen denken, vernetzt und mit dem Internet verbunden werden. Solche Geräte eignen sich daher tendenziell für Angriffe, und ich bin mir sicher, dass das nicht jedem in seiner Tragweite bewusst ist. Daher ist es unerlässlich, dass wir das Bewusstsein durch Bildung sowie Wissenschaftskommunikation für die Thematik schärfen und Sicherheitsaspekte integrierter verstanden werden. Insgesamt müssen wir das Thema Cyber Security in Politik und Recht widerspiegeln, aber es auch zum Geschäftsmodell machen: nämlich durch sichere digitale Dienstleistungen und Güter.
Unser Thema im August 2019:
Innovation | Transfer | Dt. Transfergemeinschaft

© MWIDE NRW/F. Wiedemeier
Christoph Dammermann | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW
Staatssekretär
Forschungsaktivitäten, die sich auf die berufliche und gesellschaftliche Praxis ausrichten, sind wesentliche Impulse für die Innovationsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen. Dies wird vor allem durch den „Transfer über Köpfe“ geleistet, der ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal und gleichzeitig zentraler Erfolgsfaktor für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist. Praxisorientierte Akademiker können vergleichsweise leicht zwischen Wirtschaft und Gesellschaft und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Seiten wechseln. In einem solchen Perspektivwechsel liegen große Potenziale für die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Damit sind die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften auch der wichtigste Partner der regionalen Wirtschaft, wenn es um die anwendungsorientierte Forschung sowie den Transfer von praktischem Wissen in die Anwendung geht. Davon profitiert vor Ort insbesondere der Mittelstand.
Ein enger Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist unerlässlich, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Ein gut funktionierender Wissenstransfer schafft die Voraussetzungen dafür, dass Nordrhein-Westfalen die Chancen der Digitalisierung als Vorreiter konsequent nutzen kann und damit als Standort attraktiv bleibt. Die Landesregierung unterstützt die Akteure vor Ort auch durch Entbürokratisierung und Vereinfachung – unter anderem im Rahmen der Entfesselungspakete. Der Handlungsdruck in den Gemeinden und die Bereitschaft, die Regionen wettbewerbsfähig zu halten, müssen steigen, denn Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften können dies nur gemeinsam mit weiteren Akteuren leisten. Die Zusammenarbeit der Akteure im Projekt „ruhrvalley“ ist ein gutes Beispiel hierfür.
Fachhochschule und Hochschule für Angewandte Wissenschaften tun gut daran, sich auf die Region zu fokussieren. Die aktuellen Ideen zur Vernetzung der Akteure, etwa in regionalen Innovationscampi und Partnerschaften, haben großes Potenzial. Sowohl die Vielfältigkeit als auch die regionale Vernetzung sind die großen Stärken der FH und HAW. Die Wirtschaft braucht Impulse aus dem Hochschulraum, zum Beispiel bei der digitalen Transformation. Hier besteht für die FH/HAW noch viel Handlungsspielraum.
Es gibt auf unterschiedlichen Ebenen viele verschiedene Programme zur Forschungsförderung an Fachhochschulen. Das Wirtschafts- und Innovationsministerium schafft mit Projekten wie dem Gründerstipendium oder dem Förderwettbewerb „START-UP-Hochschul-Ausgründungen“ wichtige Anreize, innovative und spannende Ideen zur Marktreife zu bringen und Nordrhein-Westfalen zum Gründerland Nummer 1 zu machen. Ob die Gründung einer „Deutschen Transfergemeinschaft“ in diesem Zusammenhang sinnvoll und nötig ist, muss klug abgewogen werden. Ich verstehe grundsätzlich den Wunsch der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften danach, über ein Pendant zur Deutschen Forschungsgemeinschaft zu verfügen. Ich frage mich allerdings auch, ob eine solche neue Institution nicht möglicherweise auch einen Beitrag zur weiteren Versäulung des Innovations- und Wissenschaftssystems darstellt. Dies hielte ich für kontraproduktiv, weil wir doch gerade mehr Interaktion und Zusammenarbeit von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen benötigen, um neue Innovationspotenziale zu erschließen.

© TH Köln
Prof. Dr. Klaus Becker | TH Köln
Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer
Beiratsmitglied HN NRW
Die FH/HAW haben in den letzten zehn Jahren ihre Aktivitäten im Bereich der angewandten Forschung sowie des forschungsbasierten Innovationstransfer massiv gesteigert. Sie sind in der Fläche des Landes NRW präsent und stehen Unternehmen und Institutionen als natürliche Partner für den forschungsbasierten Innovationstransfer vor Ort zur Verfügung. Die FH/HAW beziehen externe Partner bereits bei der Ideenfindung für neue Innovationsprojekte mit ein und entwickeln diese gemeinsam mit Ihnen. Ein modernes Transferverständnis wird in der Praxis gelebt.
Grundsätzlich besteht sowohl in der Wirtschaft wie auch an den FH/HAW die Bereitschaft eng und vertrauensvoll im forschungsbasierten Innovationstransfer zusammenzuarbeiten. Die dabei zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen werden zunehmend komplexer. Ursächlich sind die geltenden Steuergesetze und deren kontinuierlichen Weiterentwicklung wie auch der Unionsrahmen. Der erforderliche administrative Aufwand übersteigt in vielen Fällen die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zum Projektaufwand sowie zu den zu leistenden Steuerzahlungen. Durch die Einführung von Bagatellgrenzen oder Pauschalen ohne umfassende Nachweispflichten könnte eine erhebliche administrative Verschlankung erreicht werden.
Räumliche Nähe bietet die Chance der Zusammenführung von Bedarfen in der Wirtschaft mit den fachlichen Kompetenzen und personellen Kapazitäten in den FH/HAW. Dies gilt insbesondere für die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal, die wissenschaftlichen Weiterbildung von vorhandenem Personal, die Generierung und Umsetzung von innovativen Ideen oder die Nutzung von Potentialen durch Digitalisierung in Unternehmen. Die Kommunen, insbesondere außerhalb der Ballungsräume, können hier eine initiierende und koordinierende Funktion übernehmen und bei der regionalen Vernetzung von FH/HAW und Unternehmen als Katalysator für regionale Innovationspartnerschaften fungieren.
Das Land NRW verfügt mit den Professorinnen und Professoren an den FH/HAW über ein großes Potenzial an wissenschaftlichen Kompetenzen verbunden mit umfangreichen Praxiserfahrungen in Wirtschaft und Kultur. Dieses Potenzial wird unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur unzulänglich für die angewandte Forschung genutzt. Sinnvoll erscheint ein Ausbau des wissenschaftlichen Mittelbaus an FH/HAW bei gleichzeitiger Entlastung der Professorinnen und Professoren in der Lehre. Mit einem Betrag von ca. 36 Mio. Euro jährlich beispielsweise könnten in NRW flächendeckend forschungsaktive Professorinnen und Professoren an den FH/HAW in der Lehre um vier Semesterwochenstunden entlastet werden.
Eine Lücke besteht derzeit in der deutschen Förderlandschaft bei der initiativen Umsetzung von innovativen Ideen der angewandten Forschung. Es gibt keine Förderprogramme der angewandten Forschung ohne Einbindung externer Partner. Dafür sollten auf Bundes- und/oder Landesebene Mittel bereitgestellt werden. Diese Fördermaßnahmen könnten in einer Deutschen Transfergemeinschaft von der Wissenschaft selbst verwaltet werden.
Unser Thema im Juni 2019:
Akademisierung in Pflegeberufen

© Land NRW / R. Sondermann
Dr. Edmund Heller | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Staatssekretär
Durch die Pflegeberufereform wird zum 01.01.2020 erstmalig neben der bewährten fachschulischen Ausbildung ein Regelstudium in der Pflege möglich, in dem der Bachelorabschluss und die pflegerische Berufszulassung gemeinsam erworben werden. Der Prozess der Akademisierung des Pflegeberufes ist nicht nur Ausdruck einer langfristigen gesellschaftlichen Aufwertung sowie einer inhaltlichen Differenzierung und Professionalisierung zwischen berufsfachlicher und hochschulischer Ausbildung, sondern ist auch Teil der aktuellen Strategien zur Sicherung der Fachkräftepotenziale insgesamt. Ein wesentliches Argument für die akademische Pflegeausbildung besteht in der Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes durch die Möglichkeit, in diesem Beruf auch eine akademische Karriere durchlaufen zu können. Mit dieser regelhaften Qualifizierungsoption werden in Ergänzung zur bewährten fachschulischen Ausbildung Bewerberinnen und Bewerber angesprochen, die eine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben sowie Pflegende, die innerhalb oder nach der berufsfachlichen Pflegeausbildung ein Studium der Pflege absolvieren möchten.
Die akademische Pflegeausbildung stellt eine wichtige Weiterentwicklung im Gesundheitswesen dar. Die komplexer werdende pflegerische Versorgung in den unterschiedlichen Versorgungsfeldern sowie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den anderen akademischen Gesundheitsberufen benötigen neben der bewährten fachschulischen Qualifikation auch ein akademisches Kompetenzniveau auf Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens. Aus dieser Entwicklung ergeben sich viele Optionen, einen qualitativ hochwertigen Beitrag zur Versorgung im Gesundheitswesen zu leisten. Bereits seit geraumer Zeit wird die Besetzung von entsprechenden Stabsstellen in der Pflegedirektion, in der Leitung von pflegerischen Versorgungseinheiten und auch in der Qualitätssicherung durch hochschulisch qualifiziertes Pflegepersonal umgesetzt. Die Studie VAMOS, die den Verbleib von Absolventinnen und Absolventen der Modellstudiengänge untersucht und vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert wird, wird nach Abschluss in diesem Sommer differenzierter aufzeigen, in welchen Versorgungsbereichen akademische Pflegekräfte einen Versorgungsbeitrag leisten.
Die Frage nach zukünftigen Entwicklungen kann nach meiner Einschätzung kaum seriös beantwortet werden. Zur VAMOS-Studie, die federführend an der Hochschule für Gesundheit in Bochum stattfindet, wurde bereits Bezug genommen. Die Ergebnisse dieser Studie werden einen aktuellen Überblick über Tätigkeiten von Pflegeakademikerinnen und –akademikern in der Versorgungspraxis aufzeigen. Entscheidend wird sein, ob die potenziellen Arbeitgeber attraktive und verantwortungsvolle Arbeitsplätze schaffen und diese auch entsprechend vergüten.
Die Regelungen des Pflegeberufegesetzes zum Pflegestudium erfordern eine gezielte Förderung der Weiterführung bzw. Einrichtung von Studiengängen. Momentan befinden sich alle Beteiligten in einer Übergangsphase, dies gilt sowohl für die berufsfachliche als auch die hoch-schulische Ausbildung. Die Primärqualifizierung beinhaltet, dass das Studium an den Lernorten Hochschule und Praxis stattfindet. Es ist durch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2031 auch möglich, be-stehende Kooperationen zur hochschulischen Ausbildung in Studiengängen von Hochschulen mit Pflegeschulen fortzuführen. Wir sind aktuell mit verschiedenen Hochschulen zu Fragen der Ausgestaltung pflegerischer Studiengänge nach dem Pflegeberufegesetz im Gespräch und haben die Anforderungen an die curricularen Grundlagen dieser Studiengänge in einem Entwurf einer Durchführungsverordnung zum Pflegeberufegesetz formuliert. Daran kann abgelesen werden, dass wir wie auch andere Länder im Moment die notwendigen rechtlichen Regelungen gestalten, dies gilt auch für das Pflegestudium.
NRW hat im Rahmen der Modellstudiengänge in der Vergangenheit eine wichtige Führungsrolle in der Entwicklung der Akademisierung der Pflege- und Gesundheitsfachberufe eingenommen Die nach dem Pflegeberufegesetz konkret aus- bzw. aufzubauenden Studienplätze in NRW werden im Moment mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft diskutiert. Den Ausbau der akademischen Bildung der Pflege- und Gesundheitsfachberufe nehmen wir heute und auch in Zukunft ernst.

© Katholische Hochschule NRW
Prof. Dr. Wolfgang M. Heffels | Katholische Hochschule NRW
Dekan
Fachbereich Gesundheitswesen
Die Akademisierung der Pflegeberufe bietet für die Berufsgruppe der Pflegenden eine Personengruppe anzusprechen, die einen akademischen Abschluss wünschen und studieren wollen. Aus der empirischen Erhebung im Studiengang Duale Pflege, betrug der Anteil derer, die den Beruf ergriffen haben, weil er akademisch ist, ca. 20 %. Die These, die Pflege wird durch die Akademisierung attraktiver, kann aus der Sicht der Studierenden positiv beantwortet werden.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen internationaler Studiengänge und den unterschiedlichen Qualifizierungsstufen (beruflich DQR 4) und (akademisch DQR 6) können akademisch qualifizierte Pflegende, Problemstellungen umfangreicher analysieren und bearbeiten. Darüber hinaus verfügen die akademisch qualifizierten Pflegenden über eine andere Selbstwirksamkeit und Selbstdarstellung.
Zunächst ist festzustellen, dass die berufsgesetzlichen Regelungen in Qualifizierungswegen aber nicht in den vorbehaltlichen Tätigkeitsaufgaben differenziert sind. Das heißt, es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit sich in der Praxis die pflegerischen Aufgabenstellungen zwischen akademischen, beruflichen und weiterer Funktionsgruppen aufteilen wird. Hier ist die Praxis gefordert, Differenz- oder Integrationskonzepte zu entwickeln.
Die Festlegung eines Studiengangsmodells „Primärqualifizierung“ im Bundesgesetz bedeutet, dass die Hochschulen sowohl für den theoretischen als auch für die praktische Ausbildung verantwortlich sind und die Studierenden in der Praxis einen Praktikantenstatus erhalten. Die anderen Formen des dualen Studiums, wie beispielsweise ein praxisintegratives Studium, indem die Studierenden auch eine Art Vergütung erhalten und der Praxisort stärker in Verantwortung einbezogen wird, sind ausgeschlossen. Potentiell willige Studierende stehen vor der Frage, ein vierjähriges Studium ohne Bezahlung oder eine dreijährige Ausbildung mit anschließendem zweijährigen Studium zu absolvieren. Trotz guter Bafög-Bedingungen verzichten die primär qualifizierenden Studierenden in der Pflege auf eine hohe Entgeltsumme.
Leider wurde bis heute kein Sonderetat für die Studienkapazitäten im Bereich der angewandten Pflegewissenschaft vom Land bereitgestellt. Baden-Württemberg z. B. hat an dieser Stelle eine Finanzierung für einen bestimmten Anteil im Bereich Pflege fest verankert und die Hochschulen damit aufgefordert, entsprechende Kapazitäten zu erfüllen. In NRW geht man davon aus, dass durch Studienplatzumwidmungen (Abbau von anderen Studienplätzen anderer Studiengänge) neue Pflegestudienplätze etabliert werden können. Dieser Verdrängungsmechanismus führt zu erheblichen Konflikten in den Hochschulen (zwischen und innerhalb von Fachbereichen). Für neu zu etablierende Studiengänge erscheint die Baden-Württembergische Lösung zielführender und konsequenter zu sein, als das Motto „Der Hochschulmarkt wird`s schon richten“.

