
„GEMEINSAM NACHHALTIG” denken, diskutieren und handeln
Seit 2023 lädt die Nachhaltigkeitsallianz für angewandte Wissenschaften NRW (NAW.NRW) zur Ringvorlesung „GEMEINSAM NACHHALTIG“ ein: In der Vorlesungszeit gibt es immer am zweiten Mittwoch des Monats von 17:15 bis 18:30 Uhr gut verständliche Vorträge mit anschließender Diskussion – gleichzeitig online und vor Ort in der ausrichtenden Hochschule.
Die Veränderung hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise ist eine dringende und zugleich spannende Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Sie erfordert die Zusammenarbeit vieler Menschen und Institutionen, um Verbesserungen in verschiedenen Bereichen zu erreichen. Die öffentliche Ringvorlesung bietet einen Gesprächsanlass und zeigt Wege auf, wie dieser Wandel gelingen kann und an welchen Lösungen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ganz konkret arbeiten.
Dabei wird gesellschaftliche Transformation aus verschiedenen Perspektiven der Natur- und Geisteswissenschaften beleuchtet. Neben Fachwissen werden auch Chancen und Herausforderungen der einzelnen Themen verständlich vermittelt. Zu den Schwerpunktthemen gehören unter anderem Klimawandel, Energieversorgung, Raumfahrt und Architektur.
Die Live-Ringvorlesung wurde an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg konzipiert und wird vom Nachhaltigkeitsteam der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe gemeinsam mit einer hochschulübergreifenden Arbeitsgruppe organisiert. Sie findet an wechselnden Orten der beteiligten Hochschulen statt und ist zudem online über einen Livestream zu verfolgen.
Ob Bürger*innen, Studierende oder Mitarbeitende der Hochschulen – alle, die sich für aktuelle Nachhaltigkeitsthemen interessieren, sind herzlich eingeladen!
Hinweis: Wenn Sie sich für einen Termin der Ringvorlesung online angemeldet haben, erhalten Sie am Vortag der jeweiligen Veranstaltung eine E-Mail mit den Einwahl- und Zugangsdaten.
Die Vorträge der NAW.NRW Ringvorlesung im Überblick:

Nachhaltigkeitsfaktoren in der Produktentwicklung von Konsumgütern

Submikroplastik – die unsichtbare Gefahr für unsere Umwelt

Zwischen planetaren Grenzen und sozialer Verantwortung: Ein systemischer Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft
Vergangene Termine der NAW.NRW Ringvorlesung

CO₂-Recycling für grüne Chemikalien und erneuerbare Kraftstoffe mithilfe der nicht-thermischen Plasmakatalyse
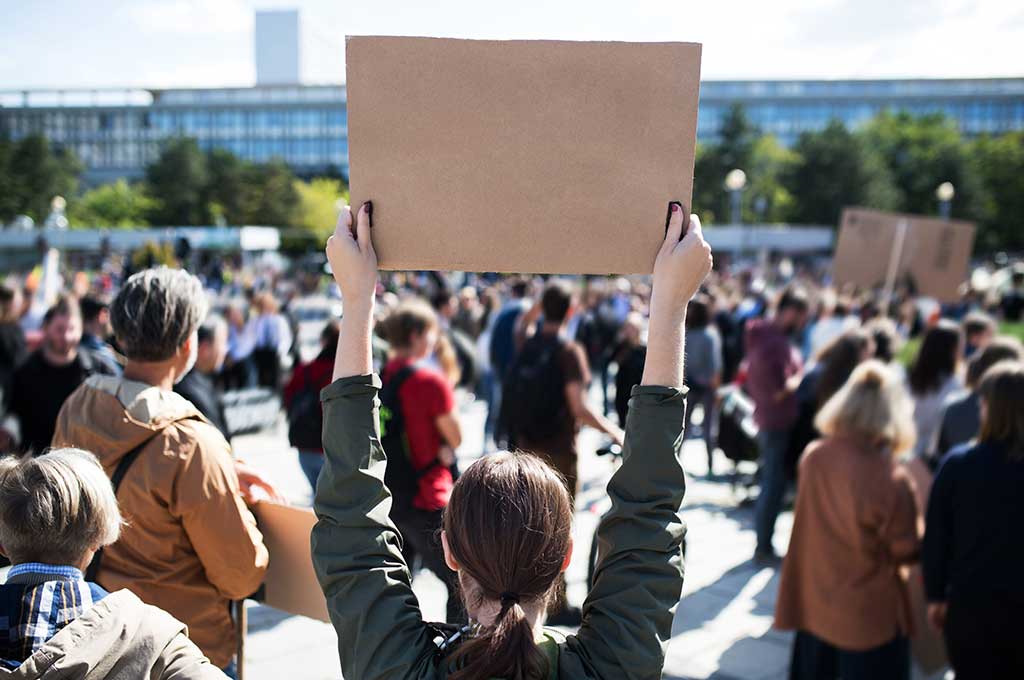
Wie sich der Rechtspopulismus des Themas Klimaschutz/Energiewende bedient!
Mittwoch, 15. Januar 2025, Hochschule Niederrhein
Prof. Dr. Beate Küpper

Unsichtbare Spuren: Umweltanalytik und ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung
Mittwoch, 11. Dezember 2024, Hochschule Hamm-Lippstadt
Dr. Ronja Kossack

Waldpädagogik und Lerngarten als Innovationen für BNE! Was bleibt übrig?
Mittwoch, 13. November 2024, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Campus Münster
Prof. Dr. Sara Remke, Prof. Dr. Jörg Rövenkamp-Wattendorf
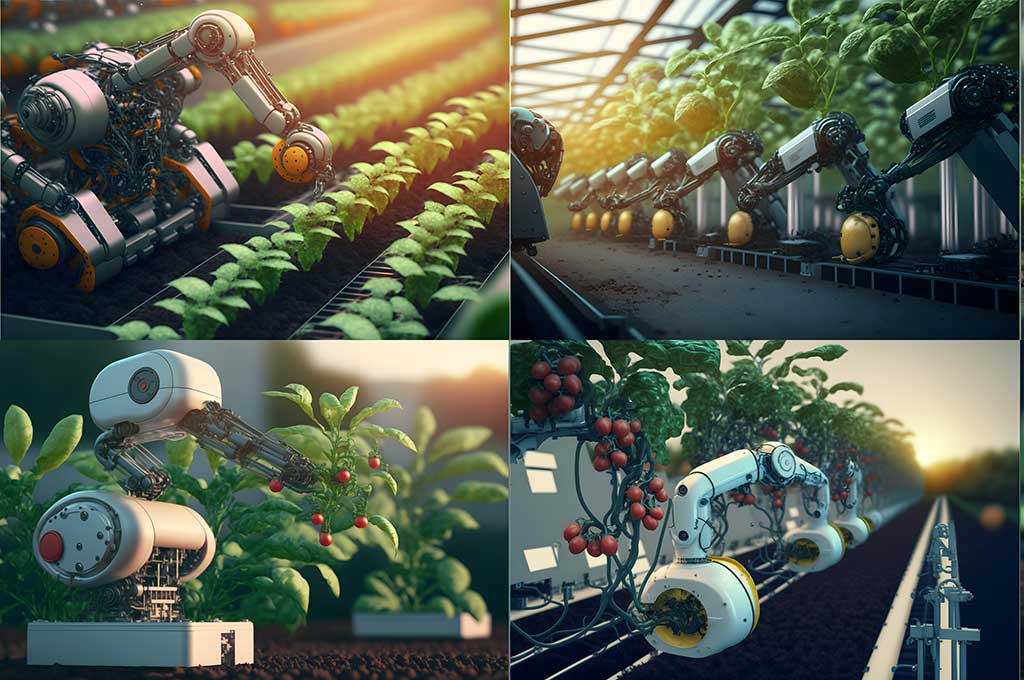
Nachhaltige Unkrautbeseitigung in der Landwirtschaft durch Agrarrobotik und KI/Maschinelles Lernen
Mittwoch, 09. Oktober 2024, FH Aachen
Prof. Dr.-Ing. Stephan Kallweit
Hier geht es zum Videomitschnitt der Vorlesung.

Nachhaltige Prozesse: Welchen Beitrag kann die Biotechnologie leisten?
Mittwoch, 10. Juli 2024, Westfälische Hochschule
Prof. Dr. Katrin Grammann

Wie viel Bergbau braucht der Mensch? Am Beispiel Kupfer
Mittwoch, 12. Juni 2024, TH Georg Agricola Bochum
Prof. Dr.-Ing. Ludger Rattmann

Sind Stroh und Lehm Baustoffe mit Zukunft? Nachhaltige und biobasierte Materialien in der Bauindustrie
Mittwoch, 15. Mai 2024, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin
Prof. Dr. Steffen Witzleben

Direkte Wasserstofferzeugung aus Sonnenenergie – ein möglicher Baustein der Energiewende
Mittwoch, 10. April 2024, Rheinische Hochschule Köln
Prof. Dr. Jörg Lampe

Wege in eine nachhaltige Textil- und Bekleidungswirtschaft durch intensiven Forschungstransfer
Mittwoch, 10. Januar 2024, Hochschule Niederrhein
Prof. Dr.-Ing. habil. Maike Rabe
Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

Solar Decathlon Europe 2021/22: Ein Blick auf das Bauen der Zukunft
Mittwoch, 13. Dezember 2023, Hochschule Düsseldorf
Prof. Dr. Eike Musall

Raumfahrt als Grundlage für das nachhaltige Management unseres Planeten
Mittwoch, 8. November 2023, FH Aachen
Prof. Dr. Ing. Bernd Dachwald
Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

Soziale Nachhaltigkeit: Was ist das?
Mittwoch, 11.Oktober 2023, Hochschule Hamm-Lippstadt
Prof. Dr. Anke Weber
Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

Brückentechnologien für nachhaltige Energieversorgung: Irrwege oder wichtige Beiträge zum Klimaschutz?
Mittwoch, 13. September 2023, TH Georg Agricola Bochum
Prof. Dr. Robin Wegge
Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

Das “E” in ESG macht den Unterschied. Umweltrisiken in und für Unternehmen
Mittwoch, 14. Juni 2023, Rheinische Hochschule Köln
Prof. Dr. Stefan Vieweg

Der Klimawandel aus kinderrechtlicher Perspektive | Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Mittwoch, 10. Mai 2023, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Prof. Dr. Kerstin Rosenow-Williams, H-BRS
Prof. Dr. Frieters-Reermann, katho NRW
Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

